

  |
|
Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |
 |
So manchen schönen Landschaftslauf haben wir verloren, und wenn es die große Runde von Unna war, die Hunderter von Illertissen und von Kusel, den Niddalauf, den Böhmweglauf. Doch die Entwicklung geht weiter. Wenn eine Tendenz erkennbar ist, dann die zu mehrtägigen Landschaftsläufen. Sie bewegen sich zwischen Tourismus wie die Alpenläufe von Heinz Schild und eisernem Wettbewerb wie dem Spreelauf von Ingo Schulze. Vor kurzem habe ich eine Nachricht aus München bekommen, inzwischen können es alle im Internet lesen. Ulrich Welzel informiert über den Internationalen Isarlauf. Eine weitere Tendenz wird sichtbar: Entlang von Flüssen. An der Donau bin ich entlang gelaufen, an der Nidda, am Neckar, trainiert habe ich schon auf dem Elbwanderweg. Ein Flußlauf am Flußlauf – das paßt zueinander. In fünf Tagen von der Isarquelle bis zur Mündung, 328 Kilometer. Gestartet wird in Scharnitz am Karwendelgebirge, die Tagesziele sind Wolfratshausen, Freising, Dingolfing und schließlich Plattling. Übernachtet wird in Turnhallen und Gemeinderäumen. Ob ich mir das noch zutrauen dürfte, täglich zwischen knapp 60 und 76 Kilometern zu laufen und zu gehen? Die Massenquartiere schrecken mich nach den Schilderungen des Transeuropalaufs noch mehr als früher. Doch ich bin jeder Überlegung enthoben. Der Start ist am 17. Mai 2004, und da findet der Rennsteiglauf statt.
Neulich rief mich ein Bekannter aus alter Zeit an. Es war Apostolos Babaitis, wie ich dann später erfuhr, denn den Namen hatte ich vergessen. Babaitis hatte, als er noch in Stuttgart lebte, die Idee eines europäischen Staffellaufes. Harry Arndt hat das damals organisiert. Babaitis ist Grieche, wie der Name sagt, und lebt nun in Spanien. Ein echter Europäer also. Er möchte im nächsten Jahr zu den Olympischen Spielen in Athen einen Staffellauf veranstalten, von Spanien, an der französischen Küste entlang, durch Italien, mit der Fähre nach Piräus. Ob ich nicht Lust hätte? Eine bestimmte Kilometerzahl am Tag sei nicht vorgegeben. So etwas hätte mich in jungen Jahren, als das Fahrrad mein Reisemittel war, durchaus gereizt. Heute ist mir das jedoch zu aufwendig.
Noch ein Anruf: Ob ich nicht einen Vortrag halten könnte über Sport und Vollwertkost. Ich bin kein Ernährungsexperte, aber während meiner Ausbildung zum Gesundheitsberater (GGB) habe ich zwar nicht kochen gelernt, aber sonst allerlei Lebenswichtiges, und ich weiß seit dem Deutschlandlauf, daß man mit vegetarischer vitalstoffreicher Vollwertkost Leistungen vollbringen kann, und zwar nicht nur heute und morgen, sondern auch übermorgen. Doch, den Vortrag werde ich halten, sofern die Sportfreunde in Wiesbaden das wünschen. Freilich, meine Neubearbeitung von „Mehr als Marathon“ zögert sich durch solche Abhaltungen weiter hinaus. Dabei stehe ich noch beim Deutschen Lauftherapiezentrum mit dem Porträt eines Wegbereiters der Lauftherapie in der Kreide.
Andy Milroy, auch ein Gefährte aus der Frühzeit des Ultramarathons, hat sich gemeldet und mich auf einen Verband der Laufstatistiker aufmerksam gemacht, die ARRS (Association of Road Race Statisticians) . Die Statistik liegt mir wahrhaftig fern, doch Andy hatte gleich einige Fragen, und so helfe ich ihm. Denn auch ich bin ein Perfektionist, und mich ärgern unvollständige Informationen und ungenaue Quellen.
Und morgen nach Berlin. Erst in den letzten Tagen habe ich festgelegt, was ich beim Literaturmarathon lesen werde. Detlef Kuhlmann hat 10 Minuten vorgegeben. Wenigstens hier keine Arbeit mehr. Es sind 10 Minuten.
![]()
Manchmal schreibt mir Günter Herburger eine Karte, auf der er einen Beitrag von mir kommentiert. Treffend, auf den Kern kommend, auch einmal ungerecht. Aus solchen Bemerkungen – diese Erfahrung habe ich vor Jahrzehnten gemacht – kann sich eine Feindschaft entwickeln. Ich habe den Eindruck, es entwickelt sich eine Freundschaft.
Günter Herburger schreibt auf meine Oktober-Kolumne: „Du wirst zum Beschützer der Altersläufer, zu denen ich auch längst gehöre.“ Altersläufer brauchen keine Beschützer, sie brauchen Interessenvertreter, Lobbyisten. Daher bin ich, als ich noch nicht alt war, vor über drei Jahrzehnten in die von van Aaken gegründete Interessengemeinschaft älterer Langstreckenläufer eingetreten. Doch die IGÄL hatte später nichts Besseres zu tun, als sich zu einer Interessengemeinschaft der Läufer, der IGL, schlechthin umzufirmieren, zu einer Zeit, in der Läufer schon keine Interessengemeinschaft mehr brauchten. Mit dem Ergebnis, daß sie gar keine Aufgabe erfüllt. Jedenfalls keine, die ihr in der Öffentlichkeit Profil gäbe. Erst recht tut sie nichts unter dem Aspekt, unter dem sie einst gegründet worden ist, nämlich die Interessen der älteren Läufer zu vertreten. Günter Herburger schreibt mir: „Zeit brauchen wir, genügend Zeit. Ich war jetzt auch schon mehrmals Letzter, was den Erzählungen darüber sehr gut tut.“ Das mag sein, aber es geht auf die Nerven, wenn man Letzter ist und der Besenläufer, kann auch eine Besen-Radfahrerin sein, begreiflich macht, daß unsereiner den Betrieb oder zumindest den Besenläufer oder die Besen-Radfahrerin aufhält. In einem Gnadenakt eine Stunde vorher zu starten, wie das Walter Stille und Alfred Pohlan beansprucht haben, ist meine Sache nicht.
Beim Thermen-Marathon in Bad Füssing, einem Bad, in dem unsere Jahrgänge sonst nur mit Krückstock oder Rollstuhl vorkommen, hat man eine Sollzeit von fünf Stunden. Mich wollten sie in diesem Jahr daher aus dem Rennen nehmen. Im nächsten Jahr werde ich da gar nicht mehr starten. Für einen Halbmarathon fahre ich nicht ein paar hundert Kilometer. Wenn man in Bad Füssing, einem Badeort der Lahmen, Behinderten und sonstigen Sozialleistungsempfänger einen Leistungslauf mit strenger Sollzeit anstrebt, mag man das tun, sollte sich aber fragen, ob das zum Konzept des Bades paßt. Ich jedenfalls, nicht lahm und nicht behindert, muß mich verabschieden und gehe dorthin, wo man mich nicht aus dem Rennen nimmt. Zeit brauchen wir, genügend Zeit. Günter Herburger und ich sind uns da völlig einig.
![]()
Nicht mehr beim Jungfrau-Marathon gewesen, dafür beim Médoc – zum drittenmal. Es war wieder ein Höhepunkt, doch auch der Karneval in Laufschuhen verschleißt sich, nicht als Veranstaltung, sondern für das Individuum. Neue Erkenntnis: Auch dort, wo die Trauben reifen, kann’s ungemütlich werden. Ich war in dem Irrglauben losgefahren, in Bordeaux sei es immer so schön wie bei den früheren Besuchen. Warm war’s, dennoch wechselte ich vor dem Start noch das Netzhemd gegen ein Funktionshemd. Und richtig, gegen 12 Uhr kam vom Atlantik der Regen. Sehr bald waren Regen und Abkühlung unangenehm. Ich war ganz froh, daß ich diesmal nicht in dem baumwollenen Badeanzug, einem Jahrzehnte alten Faschingskostüm, gelaufen war. Das Stück hätte sich mit Wasser vollgesogen. Das Funktionshemd hingegen begann zu trocknen, als der Regen glücklicherweise wieder aufhörte.
 |
Ein Nachlassen der Stimmung unterwegs habe ich nicht beobachtet. Was ich an Kostümen gesehen habe, werde ich anderswo beschreiben. Natürlich habe ich im Beruf gelernt, aus denselben Fakten zwei oder gar drei unterschiedliche Berichte zu machen; aber es macht keinen Spaß, und ich kann die Ansprüche, die ich an mich selber stelle, nicht einlösen. Die Fakten: Wieder etwa 8000 Anmeldungen. Sie sind das Limit. Und wer im nächsten Jahr, am 11. September, am 20. Médoc-Marathon teilnehmen möchte, tut gut daran, sich beizeiten anzumelden, sei es über Internet oder über das maison du vin in Pauillac, sei es über Reiseveranstalter, die eine Startnummer garantieren. Doch irgendwann haben auch die Reiseveranstalter keine Startnummer mehr. |
Bis zum Januar sollte man die Weichen gestellt haben. Von den 8000 Gemeldeten sind 7212 ins Ziel gekommen. Ich auch. Vorsichtshalber habe ich unterwegs zwar die Chateaux genossen, nicht jedoch die dort offerierten Weine. Wir Individualreisenden haben das Problem, daß wir auf das Auto angewiesen sind, und die schwarzen Figuren am Straßenrand, die auch im Médoc Dutzende von tödlichen Verkehrsunfällen markieren, sprechen eine beredte Sprache. Ganz zum Schluß, nach dem Zieleinlauf, habe ich mir schon der Symbolik wegen einen Drittel Becher Bordeaux gegönnt. Es gab ihn in einem Zelt für Läufer, in dem ein Lunch angeboten wurde. „Lunch“ war etwas zuviel gesagt, aber die Häppchen reichten durchaus. Französische Marathons zeichnen sich durch ein reiches Verpflegungsangebot aus, dieser hier besonders. Wenn doch deutsche Veranstalter ein bißchen daraus lernen würden. Nicht für unterwegs, aber für den Zielbereich. Jetzt haben wir Zeit, und jetzt möchten wir – manchmal erstmals nach dem Stunden zurückliegenden Frühstück – einen Happen essen. Und da ist dann nicht einmal mehr eine Banane da oder ein Apfel. Die „Ballade“ am Tag danach, die Weinwanderung, habe ich wieder als einen glücklichen Einfall empfunden. Die Komposition dieser Veranstaltung ist einzigartig.
![]()
Am Sonntag den Frauenmarathon der Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt. Die Moderation fand ich gut. Dafür, daß Ulrike Maisch unterwegs nicht gezeigt wurde, kann der deutsche Sender nichts; die Bilder lieferte ein französisches Team. Und Ulrike Maisch hatte nun einmal vorn nichts zu bestellen. Ihre Leistung verdient ohnehin volle Anerkennung. Vor drei Jahren noch hatte sie unter den deutschen Marathonfrauen mit 2:40:36 den 6. Platz inne. Am Sonntag war sie die einzige, die in Paris das Marathonland Bundesrepublik Deutschland vertrat.
Auch ich sah, wie zweimal eine Läuferin der Spitzengruppe stürzte. Ich bin voller Bewunderung, wie rasch sich die beiden wieder gefangen haben. Dabei ist ein Sturz bei 3:20 Minuten je Kilometer besonders schmerzhaft. Unsereiner ist schon beim 6-Minuten-Tempo, wenn es zum Sturz kam, auf dem Asphalt gerutscht. Keine Rede davon, dann auch noch die Gruppe wieder einzuholen. Und vor allem, ein Sturz bedeutet immer mehr oder weniger einen Schock. Respekt vor den Frauen dieser Klasse.
Dr. Hans-Henning Borchers hat’s nicht an die große Glocke gehängt; ich erfuhr es so nebenbei im Gespräch. Bei der Veranstaltung zum 25jährigen Bestehen des Deutschen Verbandes langlaufender Ärzte und Apotheker im Mai ist er zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Die Ehrung ist nicht nur verdient, sondern auch überfällig. Dr. Borchers hatte 1978 in München eine Idee Ernst van Aakens realisiert. Van Aaken hatte vieles angeschoben, aber ausführen mußten es andere. In diesem Falle hatte ihm die amerikanische Vereinigung laufender Mediziner vor Augen gestanden. Allerdings, eine solche Resonanz wie der Organisation in den USA war dem DVLÄ nicht beschieden. Als die Mitgliederzahl die zweihundert überstieg, galt dies schon als Erfolg. Aktivitäten des DVLÄ waren im wesentlichen das Werk von Hans-Henning Borchers, die regelmäßige Veranstaltung von Fortbildungstagungen, deren Besuch auf die Bezeichnung „Sportmedizin“ angerechnet werden konnten, die Herausgabe einer Schriftenreihe „Ausdauersport“, die jährliche Verleihung eines Van-Aaken-Preises, die Organisation von Laufveranstaltungen, der Kontakt zu Sponsoren. Die Arzthelferinnen waren zuweilen ziemlich sauer, denn die Sekretariatsarbeit für den Verband vollzog sich in der internistischen Praxis von Dr. Borchers in Augsburg. Wenn eine Ausgabe fällig war – und sei es für einige Pokale – , und es war kein Geld mehr in der Kasse, schoß Dr. Borchers aus privaten Mitteln zu. Ich weiß das deshalb, weil wir einige Jahre in ständigem Kontakt standen; ich war nach Dr. Hermann Weber aus Hannover mit der Öffentlichkeitsarbeit betraut und in den Vorstand gewählt worden. Nach fünfzehn Jahren sehr einsamer Vorsitzenden-Arbeit wurde Dr. Borchers unter dubiosen Umständen abgewählt. Er hatte ohnehin die Zeit für einen Wechsel reif gesehen, stellte sich aber auf das Zureden einiger Mitglieder, auch von mir, wieder zur Wahl, nachdem einige Monate vorher von einer (nach meiner Erinnerung) Dreier-Gruppe ein Antrag auf Enthebung vom Amt gestellt worden war. Angeblich war die Geschäftsfähigkeit des Verbandes in Gefahr. Diese Gefahr trat erst einige Zeit nach dem Abgang von Dr. Borchers ein. Wer einer akademischen Ausbildung nicht teilhaftig geworden ist, mag erkennen: Es geht unter Akademikern nicht so fein zu, wie zuweilen der Anschein erweckt wird. Erst jetzt, nachdem der Verband nach zweimaligem Wechsel des Vorsitzenden fast zum Erliegen gekommen war, hat ein relativ neuer Vorstand die zum Ausscheiden von Dr. Borchers fällig gewesene Ehrung vollzogen. Ich war nicht dabei, denn ich bin damals aus Solidarität mit Dr. Borchers aus dem Verband ausgetreten. Und die Frage, bleibt man eigentlich Ehrenmitglied, wenn man ausgetreten ist, gehört nicht zu meinen dringenden Fragen.
Außer dem Müll, mit dem amerikanische Internet-Imperialisten meinen e-mail-Briefkasten zustopfen, bekomme ich auch einen Börsenbrief. Ich weiß nicht, wem ich das zu verdanken habe – vielleicht bin ich als börsengeschädigter Kleinanleger ein interessant erscheinender Kunde. Mit dem Herausgeber verbindet mich, rein theoretisch, eines: das Laufen. Er hat neulich, wie er in seinem digitalen Börsenbrief erzählt, wieder einmal den Schlachtensee in Berlin laufend umrundet – er spricht von Joggingstrecke, also ein Nach-Achtundsiebziger. „Schon immer war es besonders motivierend, möglichst viele andere Jogger zu überholen: Mit 5 war ich zufrieden, bei 10 überglücklich und bei noch mehr schwebte ich im Himmel. An diesem Indikator gemessen, müßte ich heute in Bestform sein: Über 25 Jogger habe ich hinter mir gelassen! Die Kehrseite der Medaille jedoch ist, daß Ihr Autor diesmal von drei Joggern überholt wurde. Das war früher niemals der Fall. Und schlimmer noch: Eine davon war eine Frau (bitte nicht falsch verstehen – aber es ist wie ein zusätzlicher Nadelstich, wenn man nicht das Tempo einer Frau halten kann).“ Doch, ich verstehe falsch, vorsätzlich. Ich hoffe, der Jogger von der Börse lernt noch, was Ausdauertraining ist, und ich hoffe, er wird dabei am Schlachtensee von Helga Backhaus überrundet. Was lehrt uns dies, wenn man von anderen Läufern überholt wird? „Ähnlich muß es den professionellen Finanzmanagern zu Blasenzeiten an der Börse gegangen sein: Die Börse war zum Hobby der breiten Masse geworden.“ Pfui Teufel! „Profis mußten mit ansehen, wie Amateure ihnen die Butter vom Brot nahmen und ohne ausreichend solide Recherchen Rekordgewinne einfuhren. Obwohl Profis wußten, daß Wachstumsraten im zweistelligen Bereich nicht langfristig gehalten werden können, machten sie dies Spiel irgendwann mit: Sie beschleunigten mitten während des Rennens auf Geschwindigkeiten, die langfristig nicht haltbar waren ... und fielen somit ebenso auf die Nase, wie die Amateure.“ Ja, ja, so sind wir Läufer. Beim Laufen denken wir an die Börse. Ich bin auf die Nase gefallen, weil ich im falschen Rennen war; ich wollte mich mit dem Ertrag meiner Ersparnisse nicht abhängen lassen. Doch es gibt zu viele Leute, die selbst im Training nur eines im Sinn haben: andere zu überholen.
![]()
Etwas unheimlich ist es schon. Es ist, als ob man mit seinem eigenen Denkmal konfrontiert würde, und man möchte unter dem Albdruck der Vergänglichkeit mit dem Rest all seiner Kraft herauspressen: Ich lebe ja noch! Dabei ist man im Laufsport mit Denkmälern für Lebende sehr großzügig. Vor dem Olympiastadion in Helsinki steht das Denkmal Paavo Nurmis, das noch in der Blüte seiner Jahre angefertigt wurde; auf der Strecke des Boston-Marathons konnten der alte und der junge Kelley an ihren Ebenbildern vorbeilaufen. 1991 wurde eine Statue für Fred Lebow, den Begründer des New York-Marathons, in Auftrag gegeben, die 1994 im Central Park aufgestellt wurde; Lebow hat zwar den Festakt nicht mehr erlebt, aber er kannte die Statue. Grete Waitz hat in Oslo ihr Denkmal. Uta Pippig, deren Büste im Sportmuseum Berlin steht, ist zwar wegen des Pfeifferschen Drüsenfiebers etwas angeschlagen, läuft jedoch und hat Pläne. Das alles, nämlich daß man sein Denkmal erleben kann, mag mich trösten, denn Christian Hottas, der Gründer des 100 Marathon Clubs, hat mich mit einem Marathon geehrt, das ist fast soviel wie ein Denkmal. Nun muß man freilich wissen, der 100 Marathon Club bietet Marathons, auch wenn sonst gerade keine stattfinden. Man läuft 16,3 Runden in den Hamburger Teichwiesen. Und da es so viele Marathons in den Teichwiesen gibt, kann man sie, abgesehen von linguistischen Schwierigkeiten, nicht etwa „100 Marathon Club Marathon“ nennen; sie heißen einfach nach einer bekannten Persönlichkeit, die an diesem Tag gerade Geburtstag hat.
| In diesem Jahr fiel mein Geburtstag auf einen Sonntag, einen Marathon-Sonntag. Der entsprechende Marathon in den Teichwiesen trug meinen Namen. Etwas unheimlich ist es schon, ich wiederhole es. Ich bemühe mich zwar, die Ehrung herunterzuspielen, aber ich fühle mich auch durch sie ausgezeichnet. Dieser Tage traf eine Urkunde mit „meinem“ Marathon ein, alle Teilnehmer hatten sie unterzeichnet. Es waren im ganzen sieben. Der jüngste freilich musste sich enthalten, nicht daß er etwas gegen mich hätte – hätte ja sein können –, aber er ist der Schrift noch nicht mächtig. Er, Kes Lo, legte den Marathon im Baby-Jogger seines Vaters zurück. An Marathon-Urkunden fehlt es mir zwar nicht, aber diese habe ich aufgehängt. Warum soll nur jeder Friseurmeister die Urkunde seiner Meisterprüfung unter Glas zeigen? Um zu „meinem“ Marathon zu kommen, habe ich schließlich erst einmal sehr viele Marathons laufen müssen. So, und jetzt ist die emotionale Bewegung beim Empfang der Urkunde über meinen Marathon abgearbeitet. Ich kann mit meinem Denkmal leben. |
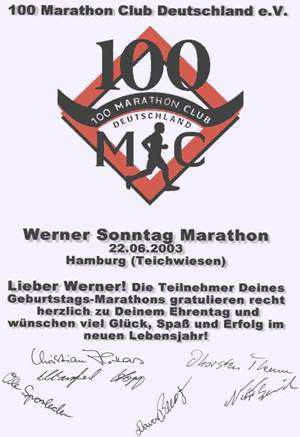 |
![]()
Jetzt müsste ich im Grunde für den Marathon des Sables trainiert sein. Die Tagestemperaturen in Marokko sollen im April 30 Grad Celsius betragen. Gegenwärtig laufe ich bei 35 Grad oder noch höheren Temperaturen. „Das ist doch nicht gesund!“ tadelte mich vor einigen Jahren eine Radfahrerin, die bei solcher Temperatur ihr Rad schob, während ich eine Brückenrampe empor lief. Es ist weder gesund, mit dem Auto zu fahren, noch ungesund, mit dem Fallschirm abzuspringen. Es ist wie mit der Nahrung: Etiketten besagen gar nichts. Es ist unsinnig, Lebensmittel in „gesund“ und „ungesund“ zu klassifizieren. Jedes sogenannte gesunde Lebensmittel kann ungesund werden, wenn die Ausgewogenheit der Ernährung nicht mehr gewährleistet ist. In Laufanleitungsbüchern steht, daß man von bestimmten Temperaturen an nicht mehr laufen soll (welche Temperatur, habe ich vergessen). Wer sich daran hält, müsste jetzt, falls er nicht fast noch in der Nacht laufen will, wochenlang auf Lauftraining verzichten. Gewiss, könnte ich meine Laufzeit umstellen. Ich gestehe, die Gewöhnung ist stark. Meine Laufzeit ist der späte Nachmittag. Viele Leute geben viel Geld dafür aus, um dorthin zu fliegen, wo es recht heiß ist. Das ist ziemlich ungesund, wenn man in gemäßigten Zonen lebt und Hitze nicht gewöhnt ist.
An Hitze kann man sich gewöhnen, an Laufen bei Hitze ebenfalls. Als ich mich seinerzeit auf den Spartathlon vorbereitete, bin ich mit voller Absicht zur Mittagszeit gelaufen. Durch Training kann man die Hitzeverträglichkeit verbessern. Ich habe wieder einmal bei Professor Dr. Georg Neumann (Leipzig) nachgelesen. Die Akklimationszeit gibt er mit fünf bis zehn Tagen an. In dieser Zeit passt sich der Organismus an; die Körperkerntemperatur und die Durchblutung der Haut erhöhen sich. So ziemlich das Dümmste, was ich vor zwanzig Jahren über den Marathon gelesen habe, war, daß dabei Temperaturen entwickelt würden, die „krankhaft“ seien, nämlich die Höhe von Fiebertemperaturen erreichten. Als Teil des Anpassungsprozesses bezeichnet Professor Neumann, daß der Körper zwar eher schwitze, aber weniger Mineralien abgebe. Bei der Untersuchung der Thermotoleranz sei man auf sogenannte Hitzeschockproteine (HSP) gestoßen, Eiweißmoleküle, die nur bei Hitzestreß gebildet würden und die Körperzellen vor weiterer Überhitzung schützten, in dem sie die Zellwände verdichteten. „Die Fähigkeit zur Bildung von HSP scheint individuell unterschiedlich zu sein“, schreibt Professor Neumann.
Erst bei Temperaturen von über 30 Grad komme es zu Anpassungsvorgängen, habe ich gelesen, und nur der Aufenthalt in warmen Klimazonen allein löse noch keine Hitzeakklimatisation aus. Erst eine sportliche Ausdauerbelastung oder die Belastung bei Hitze senkten die Kerntemperaturschwelle und setzten den Impuls, daß sich die Hautgefäße erweiterten und die Schweißbildung beginne. Um sich wirksam zu akklimatisieren, müsse man die Körperkerntemperatur auf 39 Grad bringen. Das geschehe durch Muskelbelastung bei Außentemperaturen von über 30 Grad. Professor Neumann schreibt klipp und klar: „Als Mindestbelastung empfiehlt sich ein tägliches Training von 60 bis 120 Minuten bei Hitze.“ Ausdauertrainierte kämen mit der Hitze eindeutig besser zurecht als Untrainierte.
Aber erzähle das mal einer jener Radfahrerin, die absteigt, weil ihr die Brückenrampe bei der Hitze zu steil ist!
![]()
Es gibt billigere Ferien. Nie wäre mir früher ein solcher Urlaub in den Sinn gekommen: Da wo’s teuer ist, in Davos. Bin ich vielleicht Thomas Mann? Vor Jahrzehnten leistete ich mir die Schweiz per Fahrrad und per Vespa, hintendrauf ein Zelt. Über den ersten Abenteuerspielplatz von Pro Juventute in Zürich schrieb ich, denn solche Spielplätze kannte man in Deutschland noch nicht. Ein paar Tage Tessin in der Nachbarschaft von Hermann Hesses Montagnola, später über den Gotthard auf historischen Spuren wandernd, Goethe im geistigen Gepäck, Einfahrt in den damals im Bau befindlichen Gotthard-Straßentunnel, Höhenweg in der Levantina, eine Anzahl Reisen, über die ich schreiben durfte, ziemlich früh über den Glacier-Expreß, über den Palm-Expreß, die Bernina-Bahn, Skilanglauf im Engadin, und dann nahm ich gewissermaßen beruflich am Engadiner teil, dem Skimarathon vom Silser See über St. Moritz bis vor Zuoz; der „Stern“ wollte eine Reportage darüber haben, und der Sportredakteur, der mich als Läufer kannte, setzte offenbar voraus, daß ich auch als Skilangläufer wettbewerbsreif sei. Nun ja, es ging gut, und ich bin den Engadiner noch mehrere Male gelaufen. Skilauf in Saas Fee, wo ich im Heimatmuseum entdeckte, daß Churchill in jungen Jahren keineswegs so unsportlich war, wie er sich in einem Interview zu seinem Neunzigsten gab („No sports“ als pure Ironie, die nur von deutschen Nachschreibern ernst genommen wird). 1972 kam der erste Lauf in der Schweiz, 100 km Biel. Doch da fährt man hin, startet abends und fährt womöglich zwei Stunden nach der Ankunft wieder heim.
| Der Berglauf von Sierre nach Zinal – viele Bergläufe gab es noch nicht, und dies war wohl der berühmteste, Umrundung des Vierwaldstättersees auf dem damals neuen „Weg der Schweiz“. In Martigny sah ich mir die erste offizielle Weltmeisterschaft im Frauenringkampf an, da zerrissen sich viele Kollegen in Sportredaktionen noch das Maul über ringkämpfende Frauen. Kulturgeschichtliche Recherchen zur Geschichte des Tourismus, im musealen SAC-Hotel im Maderaner Tal genächtigt, verkehrsgeschichtliche Recherchen, die Reaktivierung der Furkabahn, der attraktivsten Alpenbahn. |
 |
Über den Schweizerischen Nationalpark, einen der ältesten der Welt, schrieb ich und über die Produktion des Gruyère-Käses. So viele Erinnerungen... Im Grunde ziemlich viel Schweiz in einem Leben, obwohl ich sie mir nicht hätte leisten können. Vor 18 Jahren begann ein neues, ganz eigenes Schweiz-Kapitel, das des Swiss Alpine. Er hat mich nicht mehr losgelassen. Jedes Jahr eine Herausforderung. Er ist als feste Größe in das Jahresprogramm eingegangen: Rennsteiglauf, 100 km Biel, Swiss Alpine. Für den K 78 reicht’s nicht mehr, doch der K 42 enthält das Kernstück des K 78. Und Andrea Tuffli hat immer wieder eine Strecke erfunden, die auch dem Ältesten noch die Chance bietet, sie zu bewältigen. Neuerdings den C 42, den Lauf bis Bergün, und sollte ich auch da zu lange unterwegs sein, gibt es noch den Lauf bis Filisur. Wieder habe ich mich gefragt: Muß es der K 42 sein? Zur Kesch-Hütte wandern, zum Scaletta wandern, und, da ich immer vorsichtiger werde, auch bei Abstiegen wandern. Man muß das schon hinterfragen. Doch noch immer bin ich nicht der Letzte. Und so bin ich auch mit meiner diesjährigen Ankunft zufrieden. Wenn die Patella nicht wackelt, wird’s wohl auch im nächsten Jahr noch der K 42 sein. Eine Woche in Davos, das habe ich anfangs als Akklimatisierung ausgegeben. Doch ich bin ehrlich, selbst wenn es nur noch für die 30 km nach Filisur reichen würde, das tiefer liegt als Davos, würde ich hier wohl eine Woche Urlaub machen. Sicher, woanders könnte ich dafür drei Wochen finanzieren. Doch ich bin für Qualität, beim Laufen, beim Leben.
Nun freue ich mich auf den dritten Médoc. Doch sechs Sommerwochen ohne einen Marathon, ist das nicht ein bißchen lang?
![]()
Fast hätte ich diesen Lauf verpaßt. Er war zwischen Graubünden-Marathon und Swiss Alpine nicht vorgesehen. Ich hätte einen der schönsten Landschaftsmarathons, der es mit dem Jungfrau-Marathon aufnehmen kann, verpaßt. Er war als der erste deutsche Alpin-Marathon angekündigt worden. Wenngleich er im Voralpenland gestartet wird, so wird doch der Anspruch einer alpinen Strecke eingelöst.
Nun meinte ich zwar, mit dem Graubünden-Marathon und dem K 42 des Swiss Alpine sei genug Alpines im Programm. Aber eine Premiere reizt; außerdem sind 1708 Meter Höhe keine 2800 Meter und 2000 Meter Höhendifferenz keine 2700, und der höchste Punkt, die Bergstation der Hochgratbahn, würde bald nach dem Halbmarathon erreicht sein. Start und Ziel in dem Schroth-Kurort Oberstaufen im Allgäu. Da kenne ich mich einigermaßen aus, habe ich doch vor etwa zehn Jahren den Marco-Polo-Reiseführer Allgäu geschrieben, die Aktualisierung allerdings aufgegeben, weil ich keine Telefonnummern mehr recherchieren mochte. Schon ungewöhnlich, die Halbmarathonmarke von der Hotelterrasse in Startnähe ausmachen zu können. Der Wirt und Wanderführer sagte: „Sie haben Mut!“ Nun ja, den braucht man zu jedem Marathon. Und zwischen dem 792 Meter hoch gelegenen Oberstaufen und dem Kulminationspunkt liegen ja noch nicht einmal 1000 Höhenmeter. Mit dieser sehr lockeren Einstellung begab ich mich auf den Sportplatz in dem Oberstaufener Ortsteil Kalzhofen, wo wir starteten.
Da dies ein Tagebuch ist und keine Laufzeitschrift, werde ich den Teufel tun und den Lauf beschreiben. Ein Tagebuch schreibt man für sich und stellt seine Befindlichkeit dar. Wenn das andere Menschen interessiert, um so besser. Versteht sich, daß ich gerade noch in Oberstaufen das Feld im Auge hatte. Gern wäre ich am Anfang noch langsamer gelaufen, aber ich wollte den Ortsverkehr nicht aufhalten. Dann, im Wald bergauf, war ich allein. Doch nicht so ganz mehr, einen Läufer holte ich noch ein. Unser Rhythmus war etwas unterschiedlich, wie das so ist; mal ging er im Schritt, wenn ich laufen wollte, mal war er mir voraus. Ernste Menschen sprechen von „Führungsarbeit“. Ich mag solche Begriffe nicht. Wenn ich laufe, arbeite ich nicht. Ich muß ja nicht mein Geld damit verdienen. Vielmehr gebe ich’s fürs Laufen aus. Das Perverse: Je mehr jemandem ein solcher Marathon Freude macht, desto weniger wird seine oder ihre Leistung beachtet. Wenn einer mit Laufen Geld verdient, erst dann wird er öffentlich wahrgenommen. Wer bei unserem Lauf siegt, siegt ziemlich einsam.
In Steibis kam mir mein Mitläufer abhanden. Er hatte gemeint, so was läuft man nur einmal. Beim Aufstieg zum Imberg, unter der Sesselbahn hindurch, erreichte ich eine Läuferin. Sie sagte: „Ich mag nicht mehr.“ Ich tröstete sie, wo gebe es das denn sonst, daß man bei der Halbmarathonmarke schon das schwierigste hinter sich habe. Trost bringt leider häufig mit sich, daß gelogen wird. Ich wußte es nicht besser. Ob das Oberstaufen sei, fragte sie und wies, das wirklich schöne Panorama betrachtend, auf einen Kirchturm. Nein, das sei Weißach. Oberstaufen liege jenseits der Hügelkette. Sie konnte sich von dem Blick nicht lösen – oder dehnte sie nur die Atemholpause aus? Imberghaus, die Bergstation des Sessellifts, die dritte dieser Bergterrassen – die erste war der Kapf, die zweite Steibis – war geschafft. Und wieder ging es bergab. Nach den Aufstiegen ist das wahrhaftig angenehm, man kommt wieder in einen Laufrhythmus hinein; doch man muß dafür zahlen. Die gewonnenen Höhenmeter schmelzen dahin. Ein Schuldner, der mit der einen Hand seine Schuld abträgt und mit der anderen das Geld verschwendet... Das nächste Ziel die Falkenhütte, 1439 m. Noch ein Stück und der Kamm wäre erreicht, direkt auf den Hochgrat zu, den beherrschenden Gipfel, der uns auf dem Sportplatz von Oberstaufen vor Augen stand. Der Bergkamm hier gehört zur Nagelfluhkette; sie zieht sich vom Hochgrat weiter zum Mittaggipfel über Immenstadt. Diese Gratwanderung über den Stuifen, eine der schönsten des Allgäus, habe ich einmal unternommen. Sie ist das, was Bergerfahrene „knackig“ nennen. Auch dieser Bergpfad auf dem Grat vom Hohen Häderich über Eineguntkopf, vor dem wir den Grat erreicht hatten, Hohenfluhalpkopf und Seelekopf – o Rosamunde, dichte uns was! – zum Hochgrat ist „knackig“. Da endet der Pfad schon mal vor einer Gesteinsformation, über die man hinauf- oder hinabklettern muß. Beim Wandern nimmt man sich, zumal wenn man es nur als Urlaubssport betrieben hat, gehörig Zeit. Die hat man auf einem Marathon nicht. Unversehens hatten mich auf dem Grat zwei Männer eingeholt, der eine trug einen Besen im Rucksack. Fortan mußte er den entgegenkommenden Wanderern erklären, weshalb. Mir mußte er erklären, weshalb ich von den Besenläufern begleitet wurde: Der Läufer und die Läuferin hinter mir hatten aufgegeben. Plötzlich also das Gefühl, den Letzten beißen die Hunde. Immerhin, die Nähe der Besenläufer war hilfreich. Sie gaben mir Hinweise, wo ich am besten hinauf oder hinunter kam. Bei der vielbegangenen Tour zum Mittag sind solche Trittstellen markiert. Ein Stoiker sagt sich: Nicht nach rechts stürzen, da ist Österreich, und man braucht für die Versorgung eine Auslandskrankenversicherung, lieber nach links, da ist Heimat. An einer Stelle hatte die Bergwacht eine Reepschnur angebracht. Diese Passagen auf dem Grat halte ich für gefährlich, zumal bei schlechtem Wetter. Auf Réunion ist im vorigen Jahr ein niederländischer Ultraläufer tödlich abgestürzt. Ich verhielt mich stur, als gäbe es keinen Marathon, sondern es gälte, ein Wanderziel umsichtig zu erreichen. Damit hatte ich den Marathon verspielt. Veranschlagt hatte ich bis zum Hochgrat dreieinhalb Stunden, legte auf dem Grat noch eine halbe Stunde zu. Dann kam noch eine Senke mit neuem Aufstieg. An der Bergstation der Hochgratbahn waren es schließlich knapp viereinhalb Stunden. Erst beim Abholen der Startnummer hatte ich erfahren, daß der Zielschluß nach sieben Stunden war. Zweieinhalb Stunden für die zweite Marathonhälfte, das kann unsereiner gerade noch beim Stadtmarathon hinkriegen.
Meine Vorstellung, die 6,5 Kilometer Alpstraße zur Talstation der Hochgratbahn flott hinunter laufen zu können, ließ sich nicht realisieren. Nicht nur, daß das Gefälle zu stark war, vielmehr geriet ich auf dem Kies immer wieder ins Rutschen. Für solche Gefällstrecken müßte noch der spezielle Schuh erfunden werden. Ich habe den Eindruck, daß sich die Schuhhersteller um die Landschaftsläufer nicht kümmern. An der Talstation traf ich den bis dahin letzten Läufer. Den Rest der Strecke legten wir zumindest in Sichtweite zueinander zurück. Die Besenläufer hatten uns zwei Besen-Radfahrern übergeben. Eine Versuchung wehrte ich in Oberstaufen ab. Ob wir die Abkürzung zum Sportplatz nehmen sollten oder doch die markierte Strecke? Keine Frage. Wenn schon keine Wertung, dann wenigstens ein Sieg fürs Selbstgefühl, die Strecke bewältigt zu haben. Der Empfang für uns beide Letzte war überwältigend. So froh waren alle, nun endlich abbauen zu können. Nein, das ist nicht wahr. So überzeugend kann man nicht heucheln. Der Empfang paßte ins sportliche Bild. Im Kurpark hatte sich ein Herr von der Bank erhoben, nicht gar so viel jünger als ich, um uns, den beiden Letzten, zu applaudieren. Standing ovation hatte ich wirklich nicht erwartet.
Den Ausschlag gaben die zehn Stunden. Viel Zeit für einen Marathon, so scheint es. Dennoch, meine Meinung war zwiespältig gewesen. Zum einen wollte ich abwarten, wie ich Biel verkraften würde, zum anderen wollte ich wieder bei einer Premiere, dem 1. Graubünden-Marathon, dabei sein. Und nur zuschauen wie beim Zermatt-Marathon? Zuschauen kommt früh genug. Einen Marathon mit über 2700 Höhenmetern, den offenbar steilsten Marathon, anzugehen, in einer Altersklasse, die selbst bei ziemlich flachen Marathons gar nicht mehr vorkommt, zeigt sich darin schon eine Spur Realitätsverlust? Doch was gehen mich die anderen an! Von Chur nach Lenzerheide absolut machbar, dann Aufstieg zum Parpaner Rothorn 9,5 Kilometer lang, den müssen die meisten ohnehin gehend bewältigen. Durchgangszeiten waren angegeben. Von der Mittelstation der Kabinenbahn waren noch zweieinviertel Stunden Zeit, dies für noch nicht einmal 4 Kilometer. 982 Höhenmeter zwar, aber man rechnet in Wanderführern für 300 Höhenmeter eine Stunde. Und was so der Rechenkunststücke mehr sind. Die knapp zehn Stunden gaben den Ausschlag, nach Lenzerheide zu fahren, 2727 Höhenmeter hin oder her.
Die erste Bänglichkeit kam am Start auf, nur 347 Teilnehmer, überwiegend Schweizer, und die wissen, daß ihr Land eher vertikal denn horizontal zu vermessen ist. Der nächstjüngere, so entnahm ich der Teilnehmerliste, lag offenbar elf Jahre unter meinem Lebensalter. Egal, einfach die Zwischenzeiten schaffen, dann sehen wir weiter. Auf Landschaftsläufen stundenlang der letzte zu sein, das habe ich inzwischen trainiert, das beunruhigt längst nicht mehr, zumal da es immer wieder Erfolgserlebnisse gibt, nämlich nicht der letzte zu bleiben. Und richtig, bei etwa Kilometer 15 überholte ich einen Niederländer und hatte einen anderen in Sichtweite, den ich später auch zurückließ. So ein Rennverlauf kann richtig spannend sein, selbst wenn man geht und nicht läuft.
Die Strecke war hervorragend markiert. Nach Kilometer 16 jedoch – ich war einer Jugendgruppe begegnet – lag in einer Biegung ein wegweisendes Schild auf Schotter. Der Bergwanderweg führte ziemlich eben weiter. Kurzes Zögern, doch das Schild wies nach oben. An einer Baumaschine waren auch Fetzen eines Kunststoffbandes, das auch sonst an der Strecke vor Abirrungen bewahrte. Ich ging den Weg nach oben. Nach einer Weile war der Weg durch die mit Handgriff versehenen Drähte eines Weidezauns gesperrt. Manche wetteifern um Zehntel Sekunden auf der demnächst abzubauenden Tartanbahn im Stadion; die Sportteile der Zeitungen sind voll davon. Allein das Öffnen und Schließen eines Weidezauns kostet mehrere Sekunden. Sollten 345 Teilnehmer vor mir die Passage geöffnet und auch wieder geschlossen haben? Groteske Vorstellung. Dennoch, ich ging noch einige Meter an einer Alphütte vorbei und gewahrte, daß jenseits des Weidezauns der Weg in unberührtem hohen Gras endete. Wieder kurzes Zögern und Umkehr. Verlaufen kommt immer wieder vor. Entscheidend, wie man damit umgeht. Beim Donaulauf von der Schlögener Schlinge nach Hainburg war ein ziemlich prominenter Läufer, dem dies widerfuhr, darob so mißgelaunt, daß er den Beifall für sein erfolgreiches Abschneiden abwehrte. Dann sollte man sich wirklich nicht an einen Erlebnislauf wagen und lieber auf 100 km Bahn setzen. Ein Thema: Verlaufen.
Kurz und gut: Es war kein Problem, außer einem Zeitverlust, und den Niederländer kriegte ich wieder. Er zahlte es mir später heim, indem er aufgab. Auch er war fehlgelaufen, hatte es jedoch nach wenigen Metern gemerkt. Es muß sich um eine intelligente Nation handeln. In Lenzerheide eine heile Laufwelt, alles relativ eben. Auf dem Weg nach Sporz, einem architektonisch wunderschönen Dorf, blamierte ich mich. Eine Frau als Posten wies mich an: die Straße hinauf. Aber das Marathonschild wies doch nach links, und schon machte ich mich daran zu schaffen, es zu drehen. Die beiden hinter mir sollten es leicht haben. Die Dame belehrte mich, das Schild habe seine Richtigkeit, es gelte für die von oben Kommenden, und drehte den Pfahl mit dem Schild wieder zurück. Ist meine Berufskrankheit, es besser wissen zu wollen, schon soweit fortgeschritten? Ich schämte mich ob meiner Eigenmächtigkeit sehr und beschloß, nie mehr Posten ins Handwerk zu pfuschen. Der abfallende Rückweg war angenehm und führte nur ein kurzes Stück über die Straße. Zum zweitenmal am Hotel vorbei und schon bei Kilometer 33. Fortan würde es eine Wanderung werden. An der Mittelstation holte mich einer der beiden letzten Läufer ein. Auch seinen Begleiter wollte ich vorbeilassen. „Ich bin der Schlußläufer“, sagte er. Der vormals Letzte erklomm in gewaltigen Schritten die Steigungen. Das würde ich nicht im entferntesten können. Bald war er meinen Augen entschwunden. Wohin ich vor mir sah, – eine Senkrechte, ganz oben die Gipfelstation der Kabinenbahn. Der Eindruck war entmutigend. Ich fühlte mich kraftlos und spürte mein Herz. Ich hatte den Eindruck, noch langsamer zu sein als auf einer der Bergwanderungen um Davos. An einer sandigen Passage, neben der ich mich von Grasbüschel zu Grasbüschel nach oben quälte, überlegte ich, ob ich nicht lieber absteigen und von der Mittelstation die Kabinenbahn talwärts benützen sollte. Doch der Schlußläufer wies auf eine Berglehne, dort gebe es einen Alpweg, und beschrieb die ungefähre Route. Ohne den Schlußläufer hätte ich möglicherweise die Torheit begangen, das Unternehmen auf den letzten Kilometern abzubrechen. Seine Geduld strapazierte ich zwar mächtig, weil ich meinen Kreislauf nicht überfordern mochte, aber ziemlich stur tappte ich langsam weiter aufwärts, über mir schließlich das Plastictor des Marathonziels. Jenseits des Tales war ein Gewitter aufgezogen, es regnete leicht, und ich war schon der Kühle wegen sehr froh, meinen Regenanzug nicht vergeblich im Laufrucksack gehabt zu haben. Ein Sanitäter war mir sogar mit einer Decke entgegengekommen. Zeitnahme, Glückwünsche – soviel Aufmerksamkeit für einen einzelnen Läufer. 9:26:14 Stunden, 35 Minuten nach dem Vorletzten.
Im Rückblick: Eine der großen Herausforderungen meines Läuferlebens. Sie zeigte mir überdeutlich meine Grenzen, aber ich bin dankbar, daß ich sie, wie auch immer, bestehen konnte.
![]()
| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |
| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |
| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||
| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||
| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||