

  |
|
Tom Mc Nab Trans Amerika Neu übersetzt: Roman über den Transamerikalauf |
| von Werner Sonntag |
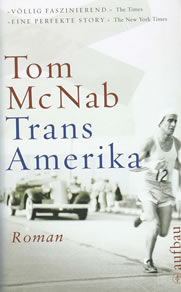 |
Wohl kaum ein Läufer bereut, sich über den 550 Seiten dieses Romans halbe Nächte um die Ohren zu schlagen. Auch wenn man zurückblickt, – er ist einer der wenigen stimmigen Läuferromane. Dabei ist er weder hohe Literatur noch tiefgründige Reflexion, es wird in angelsächsischer Tradition einfach nur eine Geschichte gut erzählt. Der Nachteil des Buches: Die deutsche Übersetzung war seit vielen Jahren vergriffen. Wer sich an einen Titel „Transamerika“ nicht erinnern kann und allenfalls an Helmut Linzbichlers Report „Der Transamerikalauf“ denkt, hat keine Gedächtnislücke. Es handelt sich bei „Transamerika“ um „Flanagan’s Run“ von Tom McNab aus dem Jahr 1982, der ein Jahr später in deutscher Übersetzung unter dem farblosen Titel „Das Rennen“ erschienen ist. Nicht nur der Titel ist geändert und sicherlich sogar anschaulicher als der englische Originaltitel. Der Roman ist auch neu übersetzt. |
„Transamerika“ hat zum thematischen Vorwurf die spektakuläre Fuß-Durchquerung des amerikanischen Kontinents von Los Angeles nach New York in der Zeit vom 4. März bis zum 26. Mai 1928, das erste Kontinentalrennen in der Laufgeschichte überhaupt. Tom McNab, ein schottischer Journalist, ist allerdings mit dem Stoff sehr frei umgegangen. Bei den Charakteren der handelnden Personen sind Anklänge an die Beteiligten vorhanden; so wie Flanagan muß man, wenn man gut über ihn denkt, sich den Sportpromoter C. C. (Spitzname: Cash & Carry) Pyle vorstellen. Eindeutiger Fakt jedoch ist im Grunde allein die Streckenführung über den damals neu trassierten Highway 66 (Los Angeles – Chicago), worunter man sich noch keine Autobahn vorstellen darf, sondern eine Kombination von Straßen höchst unterschiedlicher Beschaffenheit.
Der Autor hat den Transamerikalauf vom Jahr 1928 in das Jahr 1931 gelegt, den Höhepunkt der großen Depression. Das gibt ihm die Möglichkeit, soziale Hintergründe herauszuarbeiten. In der Tat waren wohl die wenigsten Teilnehmer des realen Transamerikalaufs aus sportlichem Ehrgeiz gekommen, sondern eher, weil sie im Gewinn eines Preisgeldes oder einer Tagesprämie ihre Chance sahen, vielfach die einzige Chance ihres Lebens. Zumindest hatten sie gegen ihre Startgebühr für einige Wochen preiswerte Verpflegung. Kritisch kann man sagen, der tatsächliche Lauf sei weniger ein sportliches Unternehmen gewesen als ein Wanderzirkus, der eine hohe, noch nie zuvor erbrachte sportliche Leistung abverlangte.
Mit der Schilderung typisierter Persönlichkeiten wie des 54jährigen erfahrenen Doc Cole, des Glasgower Bergarbeiters Hugh McPhail, des Mexikaners Juan Martinez, des Gewerkschafters und Preisboxers Mike Morgan, des britischen Lord Thurleigh, der Varieté-Tänzerin Kate Sheridan gelingt es McNab, der Masse der Teilnehmer Gesichter zu geben. Bei ihm sind es über 2000, die sich auf den Weg nach New York machten. Tatsächlich waren es im Jahr 1928 nur 199 gewesen.
McNab, der auch Leichtathletik-Trainer gewesen ist, erweist sich als sachkundig; mit dem, was er über das Laufen schreibt, mit der Schilderung der Quälerei und mit seinen historischen Reminiszenzen hat er uns laufende Leser auf seiner Seite. Die erste deutsche Übersetzung habe ich damals verschlungen, die jetzige Neuerscheinung habe ich kritisch gelesen. Und da ist mir einiges aufgefallen. Mit 46 Jahren habe Doc Cole keine 20 Kilometer mehr in der Stunde geschafft. Hoppla, dann hätte er zuvor eine olympische Medaille erlaufen müssen, sein Profil wäre ein anderes gewesen. Um unsympathische Gegenspieler zu schaffen, läßt der Autor eine Mannschaft der Hitler-Jugend laufen, 19- bis 21jährige Männer. Das Hitler-Jugend-Alter endete jedoch, außer vom Bannführer aufwärts, zu jeder Zeit mit der Vollendung des 18. Lebensjahres. Es stimmt auch nicht, daß sich die Nationalsozialisten selbst als Nazis bezeichneten. „Nazi“ war von Anfang an abschätzig gemeint und wurde allein von Nazi-Gegnern gebraucht. Historisch falsch ist auch die Aussage eines der deutschen NS-Läufer: Wenn wir an die Macht kommen, wird sich Deutschland um die Olympischen Spiele bewerben. 1931 konnte von Machtergreifung noch nicht die Rede sein, und die Idee der Olympiabewerbung stammt bereits aus dem Jahr 1929 von dem „Halbjuden“ Theodor Lewald; Hitler hat sich die Idee, die ihm wegen der Internationalität der Veranstaltung zunächst gar nicht gefiel, erst später – und wohl auf Anraten von Goebbels – zu eigen gemacht. Doping mit einem Beruhigungsmittel, das der Autor den Deutschen zuschreibt, dürfte das Gegenteil des angestrebten Zwecks erreichen. Einerseits geben Teilnehmer schon am ersten Tage nach ein paar Kilometern auf, andererseits mutet McNab im Roman den Läufern zu, den Eskapaden Flanagans zu folgen und außer dem Tagespensum von durchschnittlich 82 Kilometern auch noch lokale Wettläufe und Boxkämpfe zu bestreiten, ganz abgesehen von einer Schlägerei mit gedungenen Angreifern, die aus ideologischen Gründen den Lauf zum Abbruch führen sollte. Der Lauf gegen ein Pferd paßt zwar gut in den Stoff, ist aber innerhalb eines Transamerikalaufs eher unwahrscheinlich. Mit solchen Episoden hat Mc Nab den Roman aufgemotzt, obwohl er das gar nicht nötig gehabt hätte. Wie sich Flanagan aus allen Mißhelligkeiten, insbesondere finanzieller Art, herauswindet, ist manchmal reichlich oberflächlich. Eine einflußreiche Evangelistin muß dann geradezu als dea ex machina herhalten. Am besten ist’s also, man nimmt den Roman für nicht mehr, als er ist: fesselnde Unterhaltung in unserem ureigenen Umfeld.
Gewundert hat mich, daß ein solcher Lesestoff bei Krüger keine zweite Auflage erlebt hat. Nun hat der Aufbau-Verlag, der einst angesehene und traditionsreiche Verlag in der ehemaligen DDR, die Neuauflage veranstaltet. Verena von Koskull hat den Roman neu übersetzt. Dabei hat sie das Stil-Konstrukt der ersten Übersetzung vermieden, nämlich den Slang von Läufern durch eine künstliche, aus der Mundart im Osten Berlins destillierte Vulgärsprache wiederzugeben, die ohnehin schwer zu lesen war. Andererseits ist sie zu wenig in das Laufmilieu eingedrungen; mit Sicherheit haben Läufer auch Anfang der dreißiger Jahre bei einem solchen Unternehmen Du zueinander gesagt. Der „Sie“-Stil der Übersetzerin wirkt gestelzt. Amerikanische Maße sind umgerechnet, so daß Zeit-Angaben in Kilometern nun viel eingängiger sind als in Meilen. Was von einer Übersetzung abhängen kann, zeigt sich zum Beispiel daran, daß der erste Übersetzer, Alexander Schmitz, bei einem Laufduell von vier Fuß Abstand spricht. „Laufen Sie einfach in vier Fuß Abstand.“ Das ist unverständlich. In der neuen Übersetzung wird klar: Der Sprinter soll mental in einem 1,20 Meter breiten Tunnel laufen, nämlich nur die Bahn im Auge haben und nicht den Gegner. An einer anderen Stelle hingegen liegt die Übersetzerin falsch; sie denkt bei Eiern an die Testes und übersetzt, die Sechstageläufe seien Eierläufe genannt worden, weil die meisten sich die Eier wund gegangen seien. Da finde ich die erste Übersetzung besser; Alexander Schmitz erklärt, die Sechstageläufe seien Wobbles genannt worden, weil die Läufer mehr herumgewobbelt, nämlich hin- und hergewackelt seien (im hüftbetonten Geherstil), als zu laufen. Erstmals lese ich von Tarahumare, bei Lumholtz und allen anderen Autoren, einschließlich der ersten Übersetzung, sind es Tarahumaras.
Für beide Übersetzungen gilt: Man sollte möglichst so übersetzen, wie die deutsche Sprache zur Zeit des Ereignisses wirklich beschaffen war, sofern die Verständlichkeit nicht darunter leidet. In den dreißiger Jahren sagte niemand etwas lautstark, sondern schlicht laut. „Ansonsten“ war ungebräuchlich, man sagte, wie es auch heute das bessere Deutsch wäre, schlicht „sonst“. Den Otto Normalverbraucher gab es erst, nachdem zu Kriegsbeginn 1939 in Deutschland Lebensmittelmarken eingeführt worden waren, nicht jedoch in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren. Dazu die leider heute üblichen Sprachschlampereien: Das Verb folgen kann nicht im Passiv benützt werden („gefolgt von“). Zahllos bedeutet, man kann es nicht zählen; gemeint ist meistens: unzählig (also unzählige statt zahllose Helfer). Die Olympischen Spiele sind nicht die Olympiade; sie ist der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. „Mit die beste Zeit“ – einen Superlativ kann man nicht teilen, sonst wäre es keiner. Sind denn niemandem die Kasusfehler aufgefallen (lehren erfordert den Akkusativ)? Es gibt wohl kein Buch, in dem nicht irgend ein Eingabefehler unentdeckt bleibt. Aber diese Neuausgabe ist ausgesprochen nachlässig korrigiert worden; leider ist das heute keine Seltenheit. Was ein Rezensent bei der einfachen Lektüre findet, hätte erst recht ein Verlagsmitarbeiter finden können.
Insofern verdirbt ein Haar die Suppe, mag sie auch mundgerechter sein als die vor 25 Jahren. Insgesamt jedoch werden sich die Leser der Neuausgabe das Vergnügen nicht trüben lassen. Wer den Band an eine Läuferin, einen Läufer verschenken will, wird damit wohl immer richtig liegen.
Jedoch, die Fiction-Literatur hat Konkurrenz durch Non-fiction bekommen, und vielleicht ist die Schilderung der Realität sogar stärker als die erdichtete Darstellung. Im vorigen Jahr sind gleich zwei laufgeschichtliche Darstellungen des realen Transamerika-Laufes, des „Bunion Derby“, erschienen, „C. C. Pyle’s Amazing Footrace. The True Story of the 1928 Coast-to-Coast Run across America“ und „Bunion Derby.
 |
The 1928 Footrace across America”. Bedauerlicherweise erschwert die Idealkonkurrenz die mögliche Entscheidung darüber, ob man nicht eines ins Deutsche übersetzen sollte. Aber welches? Vorzüge haben sie beide. Vielleicht kann man den Unterschied so beschreiben: Geoff Williams, ein freier Journalist und Mitarbeiter von „Life“, erzählt die Geschichte, Charles B. Kastner dokumentiert sie. Man kann also beide lesen, ohne sich zu langweilen. Der erste Titel hebt sich insofern ab, als er zum Vergnügen von Bibliophilen die Buchgestaltung im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts imitiert; der Schnitt täuscht vor, daß die Druckbogen vom Benutzer aufgeschnitten worden sind. Leider sind auch die Bilder, die jeweils ein Kapitel einleiten, dem damaligen Design geopfert worden; sie sind nur briefmarkengroß. |
|
Die Darstellung in „Bunion Derby“ umfaßt nur etwa zwei Drittel des Textumfangs in „C. C. Pyle’s Amazing Footrace“, hat aber ausgedehnte Anhänge und ein präzises Quellenverzeichnis. Wer also nachschlagen will, zum Beispiel die Startliste, in der auch sieben Deutsche verzeichnet sind, Fred Kamier, Alfred Middlestate, Frank Nagoski, George Martin Rehayn, A. Rothschild, Herbert Tiedoke und Kurt Zimmer (George Martin Rehayn ist unter den Finishern), ist mit „Bunion Derby“ besser bedient. Die scherzhafte Bezeichnung „Bunion Derby“ hat das Transamerika-Rennen von den Journalisten jener Zeit erhalten; Bunion bedeutet entzündeter Fußballen. Beim Transamerikalauf sind alle möglichen Beschwerden aufgetreten, auch die Shin splints, versteht sich, nur eben gerade keine entzündeten Fußballen. Wahrscheinlich war die damalige Journalisten-Generation keinen Deut seriöser als die heutige. |
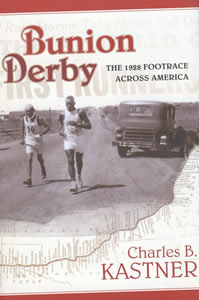 |
Aus beiden Bänden wird, anders als im Roman, der Rassismus in den USA deutlich, der in den zwanziger Jahren viel konkreter war als der bis zur Nazizeit nur ideologische Antisemitismus im Deutschen Reich.
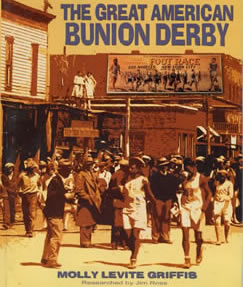 |
Außer den beiden genannten Neuerscheinungen ist bereits im Jahr 2003 unter dem Titel „The Great American Bunion Derby“ eine Biographie über Andrew Hartley Payne erschienen, den Sieger des Transamerikalaufs 1928, einen Abkömmling der Cherokee-Indianer. Er hat die etwa 5470 Kilometer in 573:40 Stunden bewältigt. Die emotionale Darstellung durch Molly Levite Griffis liest sich zwar gut und ist auch durch Jim Ross verifiziert worden, kann aber den Anspruch einer Dokumentation, den die beiden Neuerscheinungen erheben, nicht erfüllen. Man kann diesen dünnen Band, der sich wohl in erster Linie an eine jugendliche Leserschaft wendet, also nur als Ergänzung betrachten. |
Immerhin, der Transamerikalauf ist nun gründlich thematisiert; doch es hat bis zu den wissenschaftlich korrekten Darstellungen nahezu 80 Jahre gedauert. Und wer weiß, vielleicht wäre das Laufspektakel ohne den Roman von Mc Nab in der breiten Öffentlichkeit vergessen.
| Tom Mc Nab: „Trans Amerika“. Aufbau Verlagsgruppe Berlin, 2008, geb., 551 S. 22,95 €. ISBN 978-3-351-03242-5 |
| Geoff Williams: „C. C. Pyle’s Amazing Footrace.
The True Story of the 1928 Coast-to-Coast Run across America”. Rodale New York, 2007, geb., 228 S., ill., etwa 20 €. ISBN 978-1-5986-319-6 |
| Charles B. Kastner : „Bunion Derby. The
1928 Footrace across America“. University of New Mexico Press Albuquerque, 2007, geb., 242 S., ill., etwa 20 €. ISBN 978-0-8263-4301-7 |
| Molly Levite Griffis: “The Great American Bunion Derby”.
Eakin Press, 2003, broschiert, 88 S., ill., etwa 22 €. ISBN 1-57168-801-3 |
|
Gelesen und beschrieben von Werner Sonntag (im November 2008) Zurück zum Lesezirkel HIER Zu aktuellen Inhalten im LaufReport HIER |
© copyright
Die Verwertung der Texte und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport
Redaktion (Adresse siehe unter
IMPRESSUM) unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz
nichts anderes ergibt.