

 |
 |
 |
 |
 |
 |
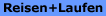 |
 |
 |
 |
 
|
|
Stavanger Marathon (NOR) - (27.08.2011) | |
|
|
 |
| Am Anfang der Fjorde | |
|
von Ralf Klink
|
Es dürfte wohl nur wenige Fälle geben, bei denen man ein Land so sehr mit einer Landschaftsform und umgekehrt auch eine Landschaftsform so sehr mit einem Land verbindet wie bei der Kombination "Norwegen" und "Fjorde". Zwar sind die vom Meer überfluteten Gletschertäler weder einzig und allein im Westen der skandinavischen Halbinsel zu finden noch besteht das nordische Königreich ganz und gar aus diesen Überbleibseln der Eiszeit. Dennoch gehören beide irgendwie untrennbar zusammen.
Dass es neben Wintersportbegriffen wie "Ski", "Loipe" oder "Bakken" praktisch nur das Wort "Fjord" geschafft hat, sich aus Norwegen auch in andere Sprachregionen zu verbreiten, kann dafür schon als guter Beleg dienen. Und tatsächlich gibt es nirgendwo auf der Welt eine Küstenlinie, die sich auch nur annähernd so zerrissen, zerfurcht und zerfleddert präsentiert wie die norwegische.
Ohnehin ist das Land im Norden Europas ja schon ziemlich schmal und langgestreckt. Selbst wenn man die in der arktischen Barentssee Nordmeer gelegene Inselgruppe Svalbard - hierzulande meist unter dem Namen ihres größten Eilandes Spitzbergen bekannt - einmal außen vor lässt, beträgt die Entfernung zwischen dem südwestlichen und dem nordöstlichen Ende rund zweitausend Kilometer Luftlinie oder dreitausend Kilometer auf der Straße.
 |
 |
| Mit dem engen und steilen Lysefjord beginnt das norwegische Fjordland im Süden gleich mit einem absoluten Höhepunkt | |
Bereits aus diesem Grund allein kann man die Küste Norwegens also nicht unbedingt unter der Rubrik "kurz" einsortieren. Die tief ins Landesinnere hinein reichenden, weit verzweigten Fjorde sowie fast unüberschaubar viele Inseln - oft ist von mehr als hunderttausend die Rede - in allen nur erdenklichen Größen lassen ihre Länge jedoch auf nahezu unvorstellbare Zahlenwerte anwachsen.
Exakt festzustellen ist sie - wie übrigens alle anderen Distanzangaben in der realen Welt auch - natürlich nicht. Denn wo man wirklich aufhört zu messen, welche Inselchen, welche Ausbuchtung des Ufers, welchen in Wasser hinein ragende Felsvorsprünge man noch berücksichtigt und welche nicht mehr, ist reine Auslegungssache.
So werden dann eben manchmal zwanzig- und manchmal über achtzigtausend
Kilometer genannt. Und praktisch alles, was dazwischen liegt, lässt sich
ebenfalls irgendwo als Angabe finden. Keine der Zahlen ist richtig. Und ebenso
wenig ist eine von ihnen falsch. Einen genauen Wert kann man halt einfach nicht
ermitteln. Doch schon der bloße Blick auf die Karte macht klar, dass es
im Verhältnis zur tatsächlich dahinter liegenden Landesfläche
weltweit eigentlich nichts Vergleichbares gibt.
Trotzdem besteht Norwegen eben nicht nur aus Fjorden. Und nicht einmal seine Küste tut das. Vielmehr erinnert sie zum Beispiel im Süden am Skagerrak mit niedrigen Bergen, fruchtbarem Hügelland, kleinen Buchten und flachen Schären deutlich eher an die schwedische und finnische Nachbarschaft als an die steilen, schroffen und engen Felsentäler weiter nördlich. Ein Stück weiter im Westen wirken die Dünen und Wiesen an der Nordsee sogar beinahe dänisch. Von Fjorden dagegen keine Spur.
Und selbst wenn es auch oberhalb von Trondheim, dort wo Norwegen endgültig zu einem schmalen Streifen zwischen Atlantik und der durch den Kamm des Skandinavischen Gebirges bestimmten Grenze zu Schweden zusammen schrumpft, sogar noch etliche richtige Fjorde gibt, fallen diese doch deutlich kleiner und bescheidener aus als ihre berühmten Brüder ganz im Westen des Landes. So lang, hoch, tief und verzweigt, so dramatisch, spektakulär, grandios und einzigartig wie dort sind die Fjorde jedenfalls nirgends.
"Vestlandet" - auf Deutsch "das Westland" - heißt diese Region in Norwegen wenig spektakulär und ziemlich nüchtern. Doch ist das eigentlich fast normal. Denn andere der fünf großen Landesteile nennen sich unter anderem "Sørlandet", "Østlandet" und "Nord-Norge" - also ebenfalls nach den jeweiligen Himmelsrichtungen. Nur das zentrale "Trøndelag" macht eine kleine Ausnahme bezüglich der Namensgebung.
 |
 |
| Fast vierzig Kilometer lang schneidet sich der Lysefjord ins zum Teil über tausend Meter aufragende Gebirge | |
Doch viel bekannter ist die Gegend - insbesondere im Ausland - natürlich als "Fjordnorwegen" oder eben "das Fjordland". Dutzende verschiedene Reiseführer und Bildbände gehen hierzulande unter jenen Überschriften über die Ladentische. Und auch die regionalen Tourismusvertreter gehen selbstverständlich mit genau diesem Etikett im Rest der Welt auf Werbetour.
Neben einigen kleineren findet man dort eben auch fünf bis sechs große, tief ins gebirgige Landesinnere hinein greifenden und sich dort in verschiedene Seitenarme auffächernde Fjordsysteme. Und aus ihnen stammt der Großteil jener Bilder, die man in der Regel im Kopf hat, wenn man an Norwegen denkt.
Den Anfang macht im Süden der im äußeren Bereich eher breite und an eine Bucht erinnernde Boknafjord. Dort jedoch, wo sich seine hinteren Verästelungen den bald bis auf eine Höhe von mehr als eintausend Meter aufragenden Bergen nähern, ändert sich die Landschaft recht schnell und wird sehr bald "typisch norwegisch".
Und ganz im Süden begrüßt gleich der allererste dieser Seitenarme, der Lysefjord die aus dieser Richtung ins Fjordland kommenden Besucher zur Eröffnung mit einem regelrechten Feuerwerk an spektakulären Fotomotiven. Zwischen hohen, steilen und blankgescheuerten Felswänden zieht er sich rund vierzig Kilometer lang, an den schmalsten Stellen aber kaum einen Kilometer breit wie eine sauber definierte Grenze für die Region schnurgerade von West nach Ost.
Weiter nördlich folgt als zweites großes System der bekannte, ja beinahe schon berühmte Hardangerfjord mit fast schon gigantischen Ausmaßen. Natürlich lässt sich auch hierbei keine exakte Länge bestimmen, insbesondere da gar nicht klar ist, wo der Fjord nun genau endet und das offene Meer beginnt, doch weit über hundertfünfzig Kilometer könnte man auf ihm mit dem Schiff entlang fahren und hätte noch immer nicht das hinterste Ende erreicht.
Alleine der auf dem Wasserweg am weitesten von der Einmündung ins Meer entfernte Sørfjord - angesichts der profanen Bezeichnung wenig verwunderlich nur einer von mindestens einem Dutzend "Südfjorden" in Norwegen - kann schließlich fast vierzig Kilometer beisteuern. Da er ähnlich wie der Lyseford ziemlich geradlinig, allerdings im Gegensatz zu diesem in Nord-Süd-Ausrichtung verläuft, eine recht klar definierten Übergang zum Hauptarm hat und auch nicht weiter verzweigt, lässt sich zumindest dieser Wert sogar relativ einfach ermitteln.
 |
 |
| Auf die Berge am Lysefjord führt keine Straße, die Aussicht muss man sich durch eine Wanderung verdienen | |
Dennoch wird der Hardangerfjord noch übertroffen, denn dem Sognefjord gesteht man in der Regel sogar mehr als zweihundert Kilometer zu. So unwahrscheinlich ist diese Angabe gar nicht einmal, finden sich doch selbst bei vorsichtigster Betrachtung seine am tiefsten ins Land schneidenden Stellen bereits in der direkten Linie fast genausoweit vom Atlantik entfernt.
Damit belegt er zwar noch immer nicht den führenden Platz in der Rangliste, denn in Grönland und im arktischen Norden Kanadas gibt es noch etwas größere Systeme. Dennoch kann der Sognefjord aber schon alleine aufgrund seiner idealen, einem sich immer weiter verästelnden Baumstamm ähnelnden Form vielleicht wirklich als das Musterbeispiel für einen Fjord schlechthin gelten.
Schon wieder ein wenig kleiner fällt der eher unbekannte Nordfjord aus, der trotz seines Namens noch lange nicht das nördliche Ende der Region darstellt. Denn mit dem Storfjord und dem Romsdalsfjord folgen noch weitere beeindruckende Exemplare, bevor die Berge zum Trøndelag hin dann doch wesentlich flacher und die Fjorde damit zwar nicht unbedingt kleiner, aber weit weniger dramatisch werden. Der Geirangerfjord, ein Nebenarm des Storfjords, im Norden von Vestlandet ist jedenfalls noch einmal ein ganz besonderer Höhepunkt.
Im Zentrum des Fjordlandes liegt zwischen Hardanger- und Sognefjord Bergen, die nach Oslo zweitgrößte und wohl auch zweitwichtigste Stadt Norwegens. Sie gilt als der klassische Ausgangspunkt für einen Besuch der Region. Doch im Süden, dort wo die Fjorde beginnen, findet sich mit Stavanger noch eine weitere größere Stadt, von der man ohne große Umschweife direkt in die vermeintlich so typische norwegische Landschaft starten kann.
Wenn überhaupt dann kennt man Stavanger zumeist höchstens als Erdölmetropole. Und die nahegelegenen Öl- und Gasfelder in der Nordsee haben tatsächlich für einen enormen Aufschwung der zuvor hauptsächlich von der Fischindustrie dominierten Stadt gesorgt. Nicht ganz zufällig hat sie zum Beispiel der norwegische Petroleumriese Statoil als seinen Hauptsitz ausgewählt. Und sogar ein eigenes Museum, das "Norsk Oljemuseum" hat man dem Öl und seiner Gewinnung gewidmet.
 |
 |
| Lebte die Stadt früher hauptsächlich von Seefahrt- und Fischfang, ist sie heute ... | … das Zentrum der norwegischen Ölindustrie, sogar ein eigenes Ölmuseum gibt es hier |
Stavanger jedoch alleine auf diesen Aspekt zu reduzieren, wird der Stadt trotzdem nicht ganz gerecht. Mit der Domkirke aus dem zwölften Jahrhundert besitzt sie zum Beispiel auch die älteste Kathedrale Norwegens. Der auf 1125 datierte Baubeginn wird allgemein als Gründungszeitpunkt der Stadt angesehen.
Doch bereits zur großen Zeit der Wikinger einige Jahrhunderte zuvor war die Gegend bewohnt. Und die ersten Spuren von Besiedlung reichen gar mehrere tausend Jahre zurück. Im ziemlich ländlich geprägten Norwegen gehört Stavanger damit jedenfalls zu den mit Abstand ältesten Städten.
Eine der einwohnerstärksten ist sie ohnehin. Betrachtet man nur die Grenzen der politischen Gemeinde, in Skandinavien mit der durchaus auch hierzulande verständlichen Bezeichnung "Kommune" versehen, landet man auf Position vier der Rangliste hinter Oslo, Bergen und Trondheim. Legt man die jeweiligen Ballungsräume zugrunde, kann Stavanger sogar Trondheim hinter sich lassen und auf Platz drei in Norwegen vorstoßen.
Entsprechend ist dann auch die Bedeutung als kulturelles Zentrum. Neben etlichen
Museen sind in Stavanger unter anderem ein Theaterhaus und eine Konzerthalle
beheimatet. Auch eine moderne Universität mit immerhin achttausend Studenten
gibt es im Stadtgebiet. Mehrere Zeitungen werden täglich herausgegeben.
Und im Jahr 2008 war man sogar einmal europäische Kulturhauptstadt.
Allerdings sollte man all dies andererseits auch nicht überinterpretieren und Stavanger für eine echte europäische Metropole halten. Das wird schnell klar, wenn man sich einmal die absoluten Zahlen ansieht. Schließlich hat Norwegen trotz einer mit Deutschland durchaus vergleichbaren Fläche kaum fünf Millionen Menschen zu bieten, von denen bereits rund ein Drittel im Großraum Oslo leben.
Bei hundertzwanzigtausend Einwohnern im eigentliche Stadtgebiet und insgesamt etwa zweihunderttausend inklusive der direkt anschließenden Nachbargemeinden hat Stavanger aus mitteleuropäischer Sicht jedenfalls maximal mittlere Größe. Man bewegt sich also doch eher in der Liga von Würzburg, Ulm, Heilbronn oder Regensburg als in der Preisklasse von München, Köln und Frankfurt.
Mit all diesen Städten - ganz egal ob man sich die absoluten oder die relativen Gegenstücke betrachtet - verbindet Stavanger jedoch, dass es dort einen Marathonlauf gibt. Mit den wirklich großen Veranstaltungen mit ihren fünf- bis zehntausend Läufern können die Norweger dabei natürlich nicht mithalten.
Doch auch zu den Rennen in den Städten ihrer eigenen Kategorie, die sich in einer deutlich kleineren Größenordnung von etwa einem Zehntel der eben genannten Zahl bewegen, fehlt noch ein ganzes Stück. Denn die in Stavanger vorgelegte Marke liegt - bei allerdings zuletzt deutlich steigender Tendenz - nur im Bereich von ungefähr einhundert Zieleinläufen.
Das ist in Norwegen zwar schon eine ganze Menge, lässt das Rennen locker unter den ersten Zehn der Größenrangliste landen und in der Regel sogar Platz vier oder fünf belegen. Trotzdem ist das Programm wenig überraschend um einen Halbmarathon sowie einen Lauf über zehn Kilometer ergänzt, die mit ihren Teilnehmerzahlen den eigentlichen Namensgeber beide eindeutig übertreffen.
Auch einen "Barneløp", einen Kinderlauf, gibt es noch. Und so liegt die Gesamtsumme der Startenden dann doch schon wieder in ganz anderen Regionen. Durch ein kontinuierliches Wachstum in den letzten Jahren hat man sich nämlich inzwischen in den oberen dreistelligen Bereich vorgearbeitet.
 |
 |
| Rund um das von früheren Lagerhäusern umgebene Hafenbecken Vågen spielt sich in Stavanger das städtische Leben ab | |
Stehen bleiben will man bei den Veranstaltern des Leichtathletikvereins GTI Stavanger dabei allerdings keineswegs. Man habe ganz andere Ziele, berichtet Einar Søndeland bei der Startnummernausgabe freimütig. Er sei "organizer of the marathon", so stellt sich der kleine, drahtige Mann mit freundlichem Lächeln auf Englisch vor, nachdem er bemerkt hat, dass die von ihm gerade in Empfang genommen Neuankömmlinge des Norwegischen nur sehr bedingt mächtig sind.
Er wolle soweit möglich jeden seiner Teilnehmer, der an diesem Freitag im etwa zwei bis drei Kilometer außerhalb des Stadtkerns gelegenen Marathonhotel seine Unterlagen abholt, persönlich begrüßen, erzählt er anschließend in aller Ruhe. Denn da sich der Andrang in Grenzen hält, bleibt bei fast allen auch noch Zeit für ein kleines Schwätzchen.
Insbesondere die wenigen ausländischen Teilnehmer wolle er kennen lernen. Denn noch habe man den Lauf eigentlich nicht groß in anderen Ländern beworben. Das soll sich allerdings ändern. Schließlich laute der Plan, die Veranstaltung bis Mitte des Jahrzehnts auf rund viertausend Teilnehmer auszubauen. Auch in die weltweite Marathonorganisation AIMS wolle man bald eintreten.
Auf den in größerer Zahl auch für die Läufer ausgelegten Presseinformationen werden die viertausend Starter - unterstützt von einem Foto, das den Zielbereich am Hafen voller Menschen zeigt - jedenfalls ganz offen als mittelfristiges Ziel genannt. Diese Werte könne man doch schließlich im nordnorwegischen Tromsø mit fast identischem Streckenangebot ebenfalls erreichen. Und diese Stadt wäre zum einen wesentlich kleiner und zum anderen deutlich abgelegener.
Nimmt man sich tatsächlich Tromsø als Vorbild, ist der Ansatz, jenseits der norwegischen Grenzen neue Teilnehmerkreise zu erschließen, mit Sicherheit nicht der schlechteste. Den Nordnorwegern ist es durch geschicktes Marketing - und vielleicht auch aufgrund der jahrelangen Schwäche des noch immer nur schwer auf die Füße kommenden Hauptstadtmarathons - nämlich irgendwie gelungen, ihre Veranstaltung im Ausland als die "einzig Wahre in Norwegen" zu verkaufen.
Kommt die Rede bei Marathonis auf Skandinavien, hört man jedenfalls viel häufiger die Frage "warst du schon in Tromsø" als "bist du schon in Oslo gelaufen". Und inzwischen treten dort sogar schon wesentlich mehr Lauftouristen aus dem Rest der Welt an die Linie als Teilnehmer aus Norwegen selbst. Die beiden Marathons in der Hauptstadt - neben dem Citylauf gibt es auch noch einen Naturmarathon im Waldgebiet Nordmarka - nimmt man dagegen anderswo kaum zu Kenntnis.
Das hat sicher mit der etwas anderen Exotik der so hoch im Norden Europas liegenden Stadt zu tun. Und auch mit dem aufgeklebten Etikett "Mitternachtssonne", die man bei einem Start am späten Abend zu sehen bekommen soll. Doch ansonsten sind in Tromsø eigentlich weder die Streckenführung noch - bei eine Stadt von nicht einmal siebzigtausend Einwohnern in einer sonst fast völlig menschenleeren Gegend nicht unbedingt überraschend - der Publikumszuspruch wirklich bemerkenswert.
Maximal die zu einem längeren Aufenthalt einladende Natur im weiteren Umfeld kann noch als Argument dienen. Doch die hat man unweit von Stavanger, wo das Fjordland beginnt, ja in fast noch spektakulärer Form auch zu bieten. Ein wenig kann man die Ideen der Marathonmacher da schon nachvollziehen. Wenn es in Nord-Norge funktioniert, warum sollte es in Vestlandet denn nicht ebenfalls klappen, eine international beachtete Veranstaltung mit mehreren Tausend Läufern auf die Beine zu stellen.
 |
 |
 |
| Farbenlehre in Stavanger: Rot für den Marathon und gelb für den Halben, im Zweifelsfall helfen aber auch noch zusätzliche Pfeile am Boden | ||
Die Bemerkung, das sei alles aber schon ziemlich ambitioniert, kontert Organisator Søndeland halb im Spaß, halb im Ernst, zuletzt habe man die selbstgesetzten Marken schließlich immer erreicht. Er gibt dann aber doch zu, dass es mit den hohen Steigerungsraten natürlich von Mal zu Mal schwieriger würde und man in diesem Jahr die angestrebte Verdopplung auf vierzehn- bis fünfzehnhundert wohl kaum schaffen wird. Tausend Teilnehmer sollten bei über siebenhundert Voranmeldungen dann aber doch heraus kommen.
Rot unterlegt sind die auf den Tischen liegenden Nummern der langen Distanz, gelb dagegen die des Halben. Und für den Zehner hat man grün gewählt. Nur beim Barneløp kommt man ohne zusätzlichen Hintergrund aus. Diese Farben werden sich dann auch während der gesamten Veranstaltung durchziehen. Denn Richtungspfeile und Kilometermarken sind ebenfalls in ihnen gehalten. Ein einfaches und logisches Konzept, das man durchaus anderenorts genauso verfolgt, das dadurch aber keineswegs schlechter wird.
Das weinrote Veranstaltungs-T-Shirt ist dagegen für alle gleich. Und obwohl die wenigsten am Ende wirklich zweiundvierzig Kilometer laufen werden, ist dennoch auf allen "Stavanger Marathon" zu lesen. Doch das kennt man hierzulande ja auch. Und manchmal tragen dann genau diejenigen diese Hemden am demonstrativsten, die mit ihrer gewählten Laufdistanz am weitesten vom Marathon entfernt waren.
Auch bei der Medaille im Ziel wird man es am Folgetag mit den Unterscheidungen übrigens nicht ganz so genau nehmen. Beides - T-Shirt und Medaille - sind im Startgeld bereits enthalten. Je nach Meldetermin beträgt es beim Marathon dreihundertfünfzig bis sechshundert norwegische Kronen. Beim Halbmarathon sind es in der gleichen Staffelung jeweils einhundert weniger.
Angesichts eines Wechselkurses zum Euro von ungefähr eins zu acht ist das zwar nun nicht unbedingt ein Schnäppchen, doch für norwegische Verhältnisse eigentlich üblich. Die Einheimischen sind solche Zahlen durchaus gewohnt. Schließlich liegt Norge nicht nur in Bezug auf das Preisniveau weltweit ziemlich vorne, auch die dazu gehörenden Einkommen sind eben entsprechend.
Ausgegeben werden diese T-Shirts übrigens, ohne dass die Nummer dazu noch einmal vorgelegt und abgehakt werden muss. Da der Tisch mit den Hemden gegenüber der Startunterlagenausgabe liegt, kann man natürlich argumentieren, dass die Helfer dort ja sowieso den Überblick haben.
Doch hat das eben auch mit skandinavischer Mentalität und Einstellung zu tun. Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang miteinander sind dort deutlich tiefer verwurzelt als anderswo. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man dem Gegenüber halt erst einmal ein gewisses Vertrauen schenkt und nicht immer gleich das Schlimmste vermutet.
Der bekannte, angeblich von Lenin stammende Spruch über gutes Vertrauen aber bessere Kontrolle wird im hohen Norden deshalb weit weniger gelebt als in den meisten anderen Ländern. Wohl nicht allzu viele Skandinavier kämen überhaupt auf den Gedanken, sich ein T-Shirt abzuholen, wenn sie nicht gemeldet hätten und bereits die dazu gehörende Startnummer in der Hand halten würden. Da muss man gar nicht mehr kontrollieren.
Dazu passt recht gut, dass selbst die Ehrenpreise für die Altersklassen auch einmal einfach so heraus gegeben werden, wenn nach dem Rennen ein platzierter Läufer am entsprechenden, mit "premiering" überschriebenen Schalter vorspricht. Weder blicken die Helfer dabei jedes Mal in die Ergebnisliste noch überprüfen sie stets die Startnummer. Die Aussage, man sei Zweiter oder Dritter geworden, genügt völlig.
Während man also ohne große Umschweife sein T-Shirt in die Hand gedrückt bekommt, erklärt Søndeland, der wie alle anderen Helfer bereits weinrot trät, als eine Art mobiler Informationsschalter schon den nächsten Ankommenden anhand der ausgehängten Karten einmal schnell die Streckenverläufe für den nächsten Tag. Das ist hat durchaus seinen Sinn, denn diese haben so ihre Besonderheiten.
Wirklich gemeinsam haben alle nämlich nur das Ziel des kleinen Hafenbeckens im Stadtzentrum. Dessen Bezeichnung "Vågen" ist wie bei den vielen Süd- und Nordfjorden auch wieder eher profan als wirklich kreativ. Denn "Våg" ist einfach nur eines der vielen norwegischen Worte für "Bucht", des "en" ist nichts anderes als der in den skandinavischen Sprachen angehängte Artikel.
Und nicht einmal besonders originell ist die Namensgebung. Auch in der inzwischen mit Stavanger zusammen gewachsenen Nachbarstadt Sandnes gibt es eine Anlegestelle mit dieser Bezeichnung, genauso in Kristiansund am nördlichen Ende des Fjordlandes. Und sogar der zentrale Innenstadthafen des knapp zweihundert Kilometer entfernten Bergen trägt den gleichen Namen.
Nicht nur zum Marathon verwandelt sich das Gelände übrigens zur Sportarena: Ende Juni wird jedes Jahr rund um das Hafenbecken Sand aufgeschüttet, um daraus mehr als ein halbes Dutzend Beach-Volleyball-Plätze zu machen. Denn praktisch die komplette Weltelite dieser Sportart kommt in die norwegische Stadt, um ein sogenanntes Grand-Slam-Turnier zu spielen. Im Jahr 2009 wurden an gleicher Stelle sogar die Weltmeisterschaften ausgetragen.
Wie in Bergen, der heimlichen Hauptstadt des Fjordlandes, wo mit dem früheren Hanseviertel Bryggen sowie der Festung Bergenhus die wichtigsten Sehenswürdigkeiten direkt am Hafen zu finden sind und die meisten anderen sich in engen Umkreis um das Becken gruppieren, ist Vågen im südlichen Eingangstor der Region, in Stavanger der absolute Mittelpunkt des städtischen Lebens.
 |
 |
 |
| In "Gamle Stavanger" - auf Deutsch Alt-Stavanger - findet man eines der größten geschlossenen Holzhausensembles in ganz Skandinavien | ||
Zwar kann man dabei mit dem Alter des einstigen deutschen Handelsstützpunktes in Bergen - dessen einstige Bezeichnung "Tyskebryggen", also "der deutsche Kai" wurde wegen der ziemlich unguten Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg im allgemeinen norwegischen Sprachgebrauch einfach verkürzt - mithalten, doch auch am Stavangerer Vågen stehen neben einigen moderneren Gebäuden alte hölzerne Lagerhäuser und geben beliebte Fotomotive ab.
In die meisten von ihnen sind Restaurants oder Cafés eingezogen. Sobald es das Wetter im kurzen nordischen Sommer auch nur einigermaßen zulässt, sind deren Außenbereiche ziemlich gut gefüllt. Direkt dahinter beginnt die schmale Gassen der Fußgängerzone Stavangers mit ihren - trotz einiger nüchterner Neubauten aus Beton - oft auch noch in traditionellen Holzhäusern untergebrachten Geschäften.
Jenseits der kleinen, aber dennoch hügligen Halbinsel, auf der sie errichtet sind, wartet am Fährhafen mit dem Ölmuseum ein weiterer wichtiger Anziehungspunkt für Einheimische und auswärtige Besucher. Nicht nur die Geschichte der Petroleumsuche und -förderung vor der norwegischen Küste wird dort erläutert. Man hat auch die Möglichkeit einige im Originalmaßstab nachgebaute Teile einer Bohrinsel besichtigen.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Vågen-Bucht kann man durch die kopfsteingepflasterten Gassen und Treppengänge von "Gamle Stavanger" schlendern. "Alt-Stavager" ist eine des größten geschlossenen Ensembles aus Holzbauten des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts in ganz Nordeuropa.
Mit buntem Blumenschmuck an den Gebäuden und kleinen Gärten eine Skandinavien-Idylle kommt es daher wie aus dem Bilderbuch. Ohne große Veränderungen könnte man praktisch sofort mit den Dreharbeiten zu einem historischen Spielfilm beginnen. Doch handelt es sich nicht im Entferntesten um ein Freilichtmuseum sondern um ein ganz normales, bewohntes und lebendiges Viertel.
Am Südende des vom Hafen aus leicht ansteigenden Platzes "Torget" - eine Bezeichnung, der man ebenfalls überall in Skandinavien begegnet, denn sie meint nichts anderes als "der Marktplatz" - steht die im Vergleich zu ihren meisten mitteleuropäischen Gegenstücken deutlich weniger monumental ausgefallene, mittelalterliche Domkirke zwischen den Bäumen einer kleinen Grünanlage.
Nicht die Kathedrale überragt deswegen die Hafenbucht, in der - noch so eine Gemeinsamkeit mit dem Bergener Vågen auch - regelmäßig sogar Kreuzfahrtschiffe vor Anker gehen. Es ist der Turm "Valbergtårnet" der an der höchsten Stelle der Landzunge mit dem Einkaufsviertel noch einmal fast dreißig Meter in die Höhe ragt.
 |
 |
 |
| Die schmalen Gassen der Fußgängerzonen grenzen direkt an die kleine Hafenbucht | ||
Der erste Eindruck täuscht, denn obwohl rund um ihn herum Kanonen stehen, wurde er keineswegs zur Verteidigung des Hafens gebaut. Vielmehr ist er ein aus dem neunzehnten Jahrhundert stammender Brandwachturm. Ein angesichts einer auch heute noch zu einem relativ großen Anteil aus Holzbauten bestehenden Stadt und mehrerer darin ausgebrochener Großbrände durchaus notwendiges Bauwerk.
Zusammen mit einigen der Lagerhäuser bildet er in stilisierter Form auch das neue Logo des Stavanger Marathons, mit dem die Organisatoren im Zuge ihrer Wachstumsbemühungen inzwischen Internetseite und Ausschreibung verzieren. Sogar ohne den in fast allen Fällen unverzichtbaren Läufer kommt man dabei aus und erreicht dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - einen ziemlichen Wiedererkennungswert.
Ein kleines, aber interessantes Detail ist, dass man darunter "Stavanger Marathon" lesen kann. Im ersten Moment erscheint das zwar völlig normal. Bemerkenswert wird es dadurch, weil man in Norwegen eigentlich "Maraton" schreibt - ohne "h". Der Gedanke, dass man bei der Gestaltung auch eine künftige internationalere Ausrichtung im Sinn hatte, ist wohl nicht allzu weit her geholt.
Das Ziel ist also für alle Distanzen in Zentrum der Innenstadt. Doch mit dem Start sieht es schon anders aus, da wird es langsam kompliziert. Denn neben den Rennen über zehn Kilometer und Halbmarathon beginnt zwar auch der Kinderlauf am Hafen. Die Langdistanzler jedoch gehen am Samstagmorgen ungefähr zwei Kilometer entfernt in einem Stadion auf ihre Strecke.
Und während sich die Kurse von Halb- und Vollmarathon in einigen Teilen decken und jeweils in einem großen Bogen weitgehend durch den südlichen Außenbereich der Stadt führen, absolvieren die Zehner ihren Wettkampf genau in der anderen Richtung auf einer nach einer kurzen Einführungsschleife zweimal zu durchlaufenden Pendelstrecke entlang des Hafenfront.
Warum sich die Organisatoren dieses doch ziemlich komplexe System ausgedacht haben, ist nicht so richtig klar. Sicher kann man durch die beiden komplett getrennten Kurse auf den kürzeren Distanzen eine Durchmischung der Felder und die damit manchmal entstehende Verwirrung vermeiden. Doch der zweite Startpunkt für den Marathon erscheint irgendwie nur bedingt logisch. Insbesondere da der halb so lange Lauf ohnehin volle zwei Stunden später gestartet wird und man sich so unterwegs eigentlich erst kurz vor Schluss begegnet.
 |
 |
 |
| Über dem Hafer erhebt sich Valbergtårnet, ein alter Feuerwachturm | Die Domkirke vom Stavanger wurde bereits im zwölften Jahrhundert errichtet und ist damit die älteste Kathedrale Norwegens | |
Bereits für halb neun ist der Startschuss im "Stavanger Stadion" angesetzt. Eine für Norwegen eigentlich recht ungewöhnlich Zeit. Denn meist beginnen die Rennen dort - und auch im benachbarten Schweden - erst um elf oder zwölf Uhr, was natürlich auch den deutlich größeren Entfernungen in Skandinavien geschuldet ist.
Trüb ist der Himmel an diesem Morgen. Allerdings ist das trotzdem fast schon eine gute Meldung. Schließlich hatte die Vorhersage eigentlich auf Nieselregen gelautet. Und das ist im Vestland nun wirklich nichts Überraschendes. Der norwegischen Westküste eilt ja der wenig vorteilhafte Ruf voraus, ein echtes Regenloch zu sein.
An hohen Bergen, die sich praktisch direkt aus dem Meer erheben und sich zudem auch noch der Hauptwindrichtung entgegen stellen, bleiben Wolken eben besonders leicht hängen. Ähnliches lässt sich unter anderem auch im amerikanischen Nordwesten mit den US-Bundesstaaten Oregon und Washington sowie der kanadischen Provinz British Columbia oder an der neuseeländischen Südinsel beobachten.
Tatsächlich hat Stavanger mit ungefähr zwölfhundert Millimetern Niederschlag im Jahr rund die doppelte Menge von Berlin oder Frankfurt zu verzeichnen. Und selbst der Wert von Hamburg, dem man hierzulande eher Schmuddelwetter nachsagt, wird um mehr als fünfzig Prozent übertroffen. Allerdings werden an der westskandinavischen Küste anderenorts noch ganz andere Zahlen notiert. Bergen vermeldet nämlich noch einmal fast doppelt so viel Regen.
Ganz so schlimm wie es sich anhört, ist es dann aber auch wieder nicht, werden doch in Stavanger im Jahresverlauf auch fünfzehnhundert Sonnenstunden gezählt. Und damit ist man durchaus im gleichen Bereich wie die meisten deutschen Städte. Man muss im norwegischen Fjordland also durchaus einmal mit Regen rechnen, nur regnet es halt beileibe nicht immer und überall.
Dafür ist es aber oft ziemlich wechselhaft und nicht unbedingt stabil. Innerhalb weniger Stunden kann man durchaus mehrere völlig verschiedene, sich schnell ändernde Wetterlagen erleben. Da sind exakte Prognosen schwierig. Und nach einem am Ende tatsächlich vollkommen regenfreien Rennen meint Søndeland deshalb auch mit einem schelmischen Grinsen, man gäbe in Stavanger nicht ganz so viel auf die Vorhersagen der Meteorologen.
Aber eigentlich entspricht das Klima im Fjordland ja sowieso nicht dessen geographischer Position auf dem Globus. Befindet es sich doch immerhin auf den gleichen Breitengraden wie der Süden Alaskas und des angrenzenden kanadischen Yukon Territoriums. Stavanger selbst liegt ziemlich genau auf der Höhe von "sørspissen av Grønland", der Südspitze von Grönland sowie zum Beispiel noch etwas nördlicher als Juneau, die Hauptstadt von Alaska.
Verantwortlich für die relativ milden Witterungsverhältnisse ist der Golfstrom, dessen Auswirkungen nicht einmal unbedingt im Sommer spürbar werden. Da ist es bei Höchstwerten von etwa fünfzehn bis fünfundzwanzig Grad in Alaska oder Nordkanada, auf Grönland oder Kamtschatka auch nicht unbedingt kälter.
Im Winter allerdings, wenn das Quecksilber in den genannten Gegenden leicht zwanzig, dreißig oder noch mehr Grad unter Null anzeigen kann, sorgt die relativ warme Meeresströmung dafür, dass die Temperaturen selbst in extremen Fällen nicht weit unter den Gefrierpunkt absacken und die Häfen entlang des gesamten Küste eisfrei bleiben. Im Gegensatz zum jenseits des - als Wetterscheide auftretenden - skandinavischen Gebirges liegenden Oslo sind Stavanger oder Bergen nicht gerade als Wintersportzentren bekannt.
Das für den Marathon als Startplatz dienende Stavanger Stadion platzt wahrlich nicht aus allen Nähten, als sich die Langstreckler langsam auf ihr Rennen vorbereiten. Denn neben der guten Hundertschaft, die sich der Distanz stellen will, bevölkern nur noch ein paar Freunde und Bekannte sowie die Helfer von GTI das Tartanoval und die blauen Sitze der Tribüne.
 |
 |
| Taschentransport auf Norwegisch: Für gut einhundert Marathonis reichen zwei Privatautos voll und ganz | Der Lauf über die Marathondistanz beginnt erst einmal mit zwei Runden im Stadion |
Oben im Sprecherhäuschen werden die letzten Startnummern ausgegeben. Und wer, da Start und Ziel ja auseinander liegen, seine Wechselbekleidung hinüber zum Hafen gebracht bekommen möchte, kann sich dort auch noch eine Markierung für die abzugebende Tasche abholen.
Dass diese ganz pragmatisch aus einem von einem Blatt abgerissenen Zettel besteht, auf den man selbst Startnummer oder Namen schreibt und ihn dann mit Sicherheitsnadeln irgendwo befestigt, ist irgendwie fast schon drollig. Es funktioniert natürlich trotzdem. Kein Gepäckstück geht verloren und im Ziel liegt alles - ohne große Bewachung, man ist schließlich in Skandinavien - bereit.
Auch der Transport selbst entspricht nicht gerade dem, was man von Großveranstaltungen kennt. Denn die Taschen, Beutel und Rucksäcke landen einfach in den Kofferräumen von zwei vor dem Stadion geparkten Autos. Selbst ein Kleinbus wäre bei diesem überschaubaren Starterfeld aber wohl eigentlich schon ein wenig überdimensioniert gewesen. Falls das gewünschte Wachstum in den nächsten Jahren allerdings erreicht wird, muss man eventuell doch auf eine andere Lösung zurückgreifen.
Doch anderseits könnte dann der Start im Stadion selbst schnell an seine Grenzen stoßen und das gewählte Procedere müsste wohl überdacht werden. Zwei Runden haben die Marathonis, die kurz vor halb neun an den Start der hundert Meter gebeten werden, nämlich erst einmal auf der Bahn zu absolvieren. Das mag für nicht einmal hundertfünfzig Teilnehmern noch gehen. Mit drei- oder vierhundert dürfte dagegen schon ein ziemliches Gewimmel herrschen. Und bei einem noch größeren Feld wäre dann wohl eher das Wort "Durcheinader" angebracht.
So schwungvoll und tatkräftig wie sich die Marathonmacher um Einar Søndeland
präsentieren, kann man allerdings irgendwie durchaus das Gefühl bekommen,
dass sie für den Fall der Fälle bereits erste Ideen in der Schublade
liegen haben. Aber noch ist es beileibe nicht so weit, diese hervor holen zu
müssen. Søndeland kann die Begrüßung der versammelten
Marathonis kurz vor dem Startschuss jedenfalls problemlos ohne Zuhilfenahme
von Mikrofon und Lautsprecher vornehmen.
Diese erfolgt übrigens zweisprachig, mit einigen zusätzlichen kurzen Worten "for the english speaking runners". Das sind zwar praktisch alle, denn es gibt kaum einen Skandinavier, der nicht ziemlich fließend auf Englisch parlieren könnte. Doch die Zahl der ausländischen Teilnehmer dürfte sich - selbst wenn Nationalitätenangaben in den Listen fehlen und man nur anhand der Namen Vermutungen anstellen kann - an maximal zwei Händen abzählen lassen.
Zwar ist in der Startnummer ein Zeitmess-Chip integriert, aber eine Startmatte sucht man - eigentlich wenig überraschend - trotzdem vergeblich. Wenn alle Teilnehmer nach zwei oder drei Sekunden die Linie überschritten haben, ist sie wohl auch kaum nötig. Doch natürlich müssen die Uhren der Anlage am Hafen dann im richtigen Moment zum Laufen gebracht werden. Und wieder hat man eine ziemlich simple Lösung parat. Der Startschuss wird nämlich einfach per Mobiltelefon in Richtung Vågen übermittelt.
Die Befürchtungen, der Kopf des Feldes könnte sich während der beiden Einführungsrunden in den Schwanz beißen, bewahrheiten sich nicht. Die Ergebnislisten werden später zeigen, dass die dafür nötige doppelte Geschwindigkeit des Ersten gegenüber dem Letzten selbst im Ziel gerade so erreicht ist. Nach gut achthundert Metern lässt man das Stadioninnere also ohne größere Abwicklungsprobleme hinter sich.
 |
 |
| Eine weitere Runde um das Stadion herum schließt sich an | |
Unter den Tribünen hindurch geht es hinaus. Doch nicht etwa auf die Straße. Außen um das Stadion herum führt ein Weg, auf den die Marathonstrecke erst einmal einschwenkt. Eine blaue Tartanspur, die wohl Mittel- und Langstrecklern ein wenig Abwechslung von Kringelziehen im Stadionrund bieten soll, gibt die Richtung vor.
Einem weiteren knappen Kilometer später ist man wieder vor der Stadiontribüne angelangt und darf nun wirklich auf den Asphalt wechseln. Doch noch ist man nicht das letze Mal an ihr vorbeigekommen. Zwei weitere, noch größere Schleifen um das Sportgelände stehen nämlich durch das umliegende Wohngebiet an.
Da gibt es im Streckenplan der sogar noch einmal in besserem Maßstab dargestellten Karte des Startbereichs etwas ziemlich verwirrendes. Zwei Runden, eine Runde, dann wieder zwei Runden, fast wie bei einer Spirale immer größer werdend. Sogar mit den eingezeichneten Kilometermarken ist es nicht ganz leicht nachzuvollziehen.
Doch die Gefahr durcheinander zu kommen und sich zu verlaufen, ist gerade wegen der sich vergrößernden Kreise in der Realität trotzdem gering. Denn selbst wenn sich auf der letzten Schleife tatsächlich Spitze und Ende des Marathonfeldes vermischen, sind die Unterschiede im Tempo so eindeutig, dass die Ordner keine Mühe haben, die Ankommenden am entscheidenden Abzweig wieder auseinander zu sortieren.
Es ist wie eine Zauberformel, die man immer dann anwendet, wenn man auf Norwegisch angesprochen wird. "Jeg er tysker", mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. "Ich bin Deutscher". Nur diese wenigen Worte in der Landessprache, die man im Zweifelsfall einfach auswendig lernen kann, genügen beinahe schon, um überall durchzukommen.
Wer dann sogar noch ein "jeg forstår litt norsk" nachschiebt und damit einerseits zu erkennen gibt, nur wenig davon zu verstehen, was man da gerade zu hören bekommt, andererseits aber zeigt, dass man sich zumindest ein bisschen bemüht, hat eigentlich schon gewonnen. Denn in der Regel wird der Gesprächspartner spätestens danach sofort auf Englisch umschwenken.
Eine Methode, die in anderen skandinavischen Ländern übrigens genauso funktioniert. Aufgrund der engen Verwandtschaft der Sprachen muss man nicht einmal groß umdenken. Der Satz ist fast der Gleiche. In Dänemark schreibt man ihn sogar praktisch genauso wie in Norwegen. Einzige Ausnahme ist, dass "lidt" ein "dt" hat und es dann natürlich "dansk" heißt. Die nur leicht andersklingende schwedische Variante lautet "Jag är tysk, jag förstår lite svenska".
 |
| Die Richtungspfeile scheinen nur für zusätzliche Verwirrung anstatt für Klarheit zu sorgen, doch so undurchsichtig, wie es im ersten Moment wirkt, ist die Streckenführung dann doch nicht |
Auch Geir Sveen führt die auf der Schleife im Wohngebiet begonnene Unterhaltung natürlich augenblicklich in Englisch weiter, als ihm die Schlüsselworte zu Ohren kommen. Er stamme aus Bryne nur ungefähr dreißig Kilometer südlich von Stavanger, erzählt er, habe also fast ein Heimspiel. Allerdings laufe er diesen Marathon dennoch zum ersten Mal. Denn eigentlich sei er eher Skilangläufer.
Eine Aussage, die man bei Laufveranstaltungen in Norwegen immer wieder einmal zu hören bekommt. Wintersport hat eben einfach eine ganz andere Wertigkeit im Land. Ein paar Zahlen machen das schnell deutlich Während beim vierundfünfzig Kilometer langen Birkebeinerlauf nämlich jeden Winter rund fünfzehntausend Menschen die Ski unterschnallen, gingen beim Oslo Marathon 2010 kaum mehr als zehn Prozent dieser Zahl über die volle Distanz.
Ein anderer dieser in Skandinavien ziemlich beliebten Volksskiläufe hat Geir Sveen zum Marathonläufer gemacht. "Sesilåmi" heißt er und wird seit mehr als drei Jahrzehnten zwischen Setesdal und Sirdal östlich des Lysefjordes ausgetragen. Bis auf über tausend Meter Höhe und damit weit jenseits der Baumgrenze führt die zweiundfünfzig Kilometer lange Loipe. Dennoch sind auch dort die zweieinhalbtausend zur Verfügung stehenden Startplätze regelmäßig ausgebucht.
Im Sommer richten die Organisatoren des Skirennens allerdings auch einen Marathonlauf aus, der einen ähnlichen Verlauf über eine Passstraße nimmt. Vom Start bei dreihundert bis auf über tausend Meter am höchsten Punkt geht es dabei hinauf. Der Zielort und Namensgeber Suleskar liegt dann aber wieder nur auf sechshundert Meter Höhe.
Mit fünfzig bis sechzig Marathonis, ungefähr der gleichen Zahl Startern beim Halbmarathon fallen die Teilnehmerzahlen aber in eine ganz andere Größenkategorie. Es gibt jedoch eine Kombinationswertung von beiden Veranstaltungen, die Sveen, der dort in bester norwegischer Tradition eine Ferienhütte hat, vor einigen Jahren bewogen hat, es auch einmal ohne Ski zu versuchen.
Inzwischen ist er schon fünfmal durch die Berge gelaufen. Nun will er sich erstmals an einen "flachen" Marathon versuchen und hofft auf eine Zeit unter vier Stunden. Dass es schon auf der großen Schleife ums Stadion immer wieder einige Meter bergauf und bergab geht, stört ihn nicht. Er registriert es vielleicht nicht einmal. Aus dem ziemlich bergigen Norwegen, wo die Hälfte der Landesfläche in einer Höhe von über fünfhundert Meter liegt, ist man ganz anderes gewöhnt.
Tatsächlich zählt die "Jæren" genannte Gegend im Süden von Stavanger zu den flachsten Regionen in ganz Norwegen. Und die höchste Erhebung der Stadt misst gerade einmal 139 Meter. Da will es eigentlich nicht richtig passen, sie als Eingangstor zum Fjordland zu bezeichnen. Doch der weite Boknafjord öffnet sich schließlich mehr oder weniger direkt im Norden Stavangers zum Atlantik hin.
Nur wenige Kilometer östlich der Stadt ragen die Berge auch bereits einige hundert Meter weiter nach oben. Mit jedem der südlichen Seitenarme des Fjordes, die man dabei überschreitet werden sie noch ein wenig höher. Und bis zu einer der absolut bekanntesten Sehenswürdigkeiten Norwegens, dem Preikestolen sind es in der Luftlinie nur etwa zwanzig Kilometer.
Rund sechshundert Meter scheint diese Felskanzel - nichts anderes ist mit dem wortwörtlich als "Predigtstuhl" zu übersetzenden Namen gemeint - praktisch senkrecht über dem Lysefjord zu schweben. Durch seine geometrische Form wirkt das quadratische Plateau mit einer Seitenlänge von ungefähr fünfundzwanzig Metern wie von Menschenhand aus dem Stein heraus geschnitten. Doch die Natur ist eben manchmal wirklich der beste Baumeister.
Der Weg zu diesem wahrlich beindruckenden Aussichtsplatz ist allerdings keineswegs so schnell zurück gelegt, wie es die kurze Distanz nahelegt. Rund eine Dreiviertelstunde benötigt man nämlich erst einmal für die Überfahrt von Stavanger hinüber zum auf der östlichen Seite der Bucht gelegen Fährhafen Tau.
Von dort sind es noch knappe zwanzig Autokilometer - die letzten davon auf einem ziemlich schmalen Sträßchen - bis zum Parkplatz. Abgestimmt auf die Abfahrtszeiten der Schiffe verkehrt, wie es sich für eine solche Touristenattraktion anscheinend gehört, für alle Nichtmotorisierten vom Fähranleger sogar ein Bus dorthin.
Doch wenn man glaubt einfach nur aussteigen, ein paar Schritte gehen und dann auf den Auslöser der Kamera drücken zu können, irrt man gewaltig. Wie viele Naturschönheiten in Skandinavien muss man sich auch den Preikestolen redlich verdienen. Denn noch stehen mehrere Kilometer Fußmarsch über nicht immer wirklich gut ausgebaute Pfade und zum Teil beinahe schon unwegsames Gelände an.
 |
 |
 |
| Die rund sechshundert Meter hohe, praktisch senkrecht abfallende Felsenkanzel Preikestolen ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Norwegens | ||
Wer aus den Alpen ein engmaschiges, perfekt gepflegtes und ausgeschildertes Wanderwegenetz kennt und dieses auch im Norden Europas erwartet, wird bald ziemlich enttäuscht sein. Zumeist besteht ein norwegischer "Tursti" aus kaum mehr als in regelmäßigen Abständen auf Felsen und Bäumen angebrachten Markierungen - in der Regel ein rotes "T" - zwischen denen man sich die beste Verbindung selbst suchen muss.
Der Weg zum Preikestolen ist deshalb noch einer der besseren. Die Richtung ist auch aufgrund der zahlreich hinauf strömenden Touristen klar zu erkennen und eigentlich nicht zu verfehlen. Und einige moorige Abschnitte unterwegs, in denen man sich fast überall sonst beim Wandern in Norwegen ohne die dort üblichen Gummistiefel unvermeidlich nasse Füße holen würde, sind sogar mit Bohlenwegen überbaut.
Aber selbst wenn die meist angegebenen Gehzeiten von jeweils zwei Stunden für Hin- und Rückweg wohl doch eher auf Untrainierte ausgelegt sind, ist die - übrigens vollkommen ungesicherte - Felsenkanzel hoch über dem Fjord eben keineswegs mit einem kleinen Spaziergang sondern nur mit einer durchaus ernstzunehmenden Bergwanderung erreichbar.
Für andere gelegentlich in Norwegenprospekten auftauchende spektakuläre Fotopunkte wie der ebenfalls am Lysefjord zu findende, zwischen zwei Felswänden eingeklemmte Gesteinsbrocken "Kjeragbolten" oder die mehrere Meter überhängende schmale Felsnase "Trolltunga" - die Trollzunge - am Hardangerfjord werden als Anmarsch dann allerdings eher drei, vier oder fünf Stunden genannt. Pro Richtung wohlgemerkt.
Kein Wunder also, dass Geir Sveen trotz einiger Wellen, die sich bis zum Ziel auf ein- bis zweihundert Meter aufsummieren werden, den Kurs in Stavanger für ziemlich flach hält. Das Stadion, in dem der Marathon gestartet worden war und das man noch immer umrundet, sei früher die Spielstätte des Fußballklubs Viking Stavanger gewesen, berichtet er. Doch nun hätte man ein wenig außerhalb ein neues gebaut, das man später auch noch passieren würde.
Nun kann man sich ja vorstellen, dass in Norwegen mit seinen eher geringen Einwohnerzahlen keine riesigen Sportarenen benötigt werden. Aber die wenigen und nur auf einer Seite bestehenden Sitzreihen scheinen selbst dafür ziemlich unterdimensioniert. Nein, nein, entgegnet Sveen, das alte Stadion habe wie das neue auch rund siebzehntausend Menschen gefasst und natürlich rundherum Tribünen gehabt. Nur habe man diese jetzt abgerissen.
Nach vier Kilometern sind die kleinen, mittleren und großen Runden um das Sportgelände dann aber doch zu Ende und der Kurs dreht in die andere Richtung ab. Geir Sveens Bemerkung, dass man dabei gerade durch eines der besten Wohngebiete von Stavanger laufe, lässt sich beim Blick auf die umliegenden Häuser nur schwer widerlegen.
Zwar bekommen selbst die größten norwegischen Städte außerhalb des absoluten Kernes sehr bald etwas fast schon ländliches und bestehen hauptsächlich aus Einfamilienhäusern mit großen Gärten. Stavanger bildet da keineswegs eine Ausnahme. Ganz im Gegenteil ist dieser Effekt angesichts eines ziemlich kleinen echten Zentrums sogar besonders ausgeprägt. Aber die Gebäude, an denen man gerade vorbei kommt sind eben doch etwas größer und vornehmer als üblich.
Doch nicht lange kann man sie bewundern. Eine Fußgängerbrücke bringt die Läufer kreuzungsfrei über eine Hauptstraße und endet in einem Park. "Mosvatnet" heißt der kleine See, der den Hauptteil der Grünanlage in Beschlag nimmt. Nur zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt lockert er die ohnehin schon recht lockere Bebauung noch weiter auf.
Dennoch gibt es keine norwegische Kommune mit einer größeren Besiedlungsdichte. Und das sogar mit ziemlich großem Abstand. Sie ist ein volles Drittel höher als in Oslo, das im Land Platz zwei in dieser Wertung belegt, und sogar mehr als dreimal so hoch wie in Bergen. Mit knapp 1800 Menschen pro Quadratkilometer erreicht die Stadt im Gegensatz zu den restlichen norwegischen Gemeinden jedenfalls einen auch hierzulande durchaus üblichen Wert.
Das in seiner räumlichen Ausdehnung eher begrenzte Stavanger hat nämlich weder die riesigen Wälder der norwegischen Hauptstadt noch die "syv fjell" Bergens. Während andere Städte sich mit sieben Hügeln brüsten, ragen dort rund um den Stadtkern sieben vier- bis sechshundert Meter hohen Gipfel empor. "Floyen", der bekannteste unter ihnen, findet sich direkt hinter dem Vågen-Hafen. Vom Bryggen-Viertel bis zur Talstation der Standseilbahn sind es nur wenige Schritte.
Stavanger kann nichts dergleichen bieten. Und trotzdem ist die Marathonstrecke ziemlich grün, wie die nächsten sechs Kilometer rund um das Mosvatn belegen. Denn noch immer ist das Kringel drehen nicht beendet. Zwei Mal muss der See vollständig umkreist werden, dann erst, nachdem sie bereits ein Viertel der Distanz hinter sich gebracht haben, werden die Marathonis endgültig auf ihre große Schleife entlassen.
Da die Seeumrundung noch einmal deutlich weiter ausfällt als die bisherigen Schlingen, haben die Helfer an ihren Beginn und Ende sowie der an dieser Stelle ebenfalls aufgebauten, auf diese Art sogar dreimal zu nutzenden Verpflegungsstelle, wiederum keine wirklichen Probleme, die Übersicht zu behalten, wer wohin weiter laufen muss.
Erneut schaffen nämlich nur die Allerschnellsten eine Überrundung
der deutlich Langsameren. So unlogisch und verwirrend wie es im ersten Moment
auf der Karte aussieht, ist das Ganze eigentlich gar nicht. Und es steht zu
vermuten, dass die Streckenarchitekten das durchaus genau so einkalkuliert haben.
Eigentlich sollte man auch von den Läufern selbst erwarten können, bis zwei zu zählen. Zumal sie ja bereits beim ersten Mal die Kilometerschilder für den zweiten Durchlauf passiert haben. Einen kleinen Lapsus der ansonsten praktisch fehlerlosen Organisation können Aufmerksame auf den weitgehend geschotterten Wegen am Seeufer allerdings doch entdecken. Denn die rote "5" steht etwa dreißig Meter vor der "8", die "6" vor der "9". Aber dann läuft man zuerst an der "10" vorbei und dann an der "7". Eine Verwechslung ohne große Auswirkungen.
Auch gelbe Markierungen stehen an den Uferpfaden. Denn am Mosvatn treffen Halb- und Vollmarathonkurs erstmals aufeinander. Es sind allerdings nicht ganz so viele Schilder in dieser Farbe. Die vom Hafen kommenden Teilnehmer der kürzeren Distanz werden den See nämlich später nur ein- und nicht gleich zweimal umlaufen.
Die sich so seltsam kreuzenden Richtungspfeile am Boden vor der Getränkestelle beenden jedenfalls für beide Strecken die Runde. Statt auf schlenkrigen Schotterwegen am Wasser geht es nun erst einmal auf einem asphaltierten Radweg entlang der vorhin überquerten Hauptstraße weiter.
 |
 |
| Zwei Runden müssen um den See mit Namen Mosvatnet absolviert werden, die erste Verpflegungsstelle kann man so gleich dreimal nutzen | |
Gesonderte Trassen für Zweiräder sind, obwohl sich das Land von der Topographie her nun wahrlich nicht gerade radfreundlich präsentiert, absolut nichts Ungewöhnliches in Norwegen. In den Städten sowieso. Doch auch bei der Fahrt über Land begegnet man immer wieder kilometerlangen, in der Regel sogar asphaltierten Pisten neben der Straße. Doch bleiben eben eingezwängt zwischen Felswand und Fjord für andere Streckenführungen oft auch kaum Alternativen.
Man fährt durchaus viel Rad im hohen Norden. Beleg dafür sind vielleicht weniger die momentanen Erfolge der Profis Thor Hushovd und Edvald Boasson Hagen als vielmehr die Teilnehmerzahlen des am gleichen Tag wie der Stavanger Marathon stattfindenden Birkebeinerrittet. Zum über neunzig Kilometer langen Mountain-Bike-Rennen, das einer ähnlichen Strecke folgt wie der Skilanglauf im Winter treten nämlich ebenfalls rund fünfzehntausend Sportler an.
Noch eine dritte Veranstaltung gehört zu dieser Familie, die sich zumindest das gemeinsame Ziel im Olympiaort Lillehammer teilt. Sie heißt "Birkebeinerløpet". Vielleicht liegt es nur am bekannten Namen, doch zumindest bei diesem Gelände-Halbmarathon zeigen die Norweger, dass sie auch ohne Ski oder Fahrrad in großer Zahl unterwegs sein können. Immerhin siebentausend Läufer gehen nämlich dabei in mehr als dreißig zeitlich gestaffelten Startwellen auf die Strecke.
Der Radweg steigt leicht an. Er führt hinauf in die zweite Etage eines Straßenkreisels. Denn in einer ziemlich zweckmäßigen Lösung haben die norwegischen Verkehrsplaner hoch über den Autos einen weiteren Ring aus Brücken für Fußgänger und Radfahrer konstruiert. Über Rampen auf allen Seiten kann so ohne Ampeln oder Zebrastreifen - an denen die Autofahrer im Norden Europas übrigens tatsächlich beinahe immer stehen bleiben, wenn man sie überqueren will - jede beliebige Richtung eingeschlagen werden.
Für die Macher des Laufes eine nahezu ideale Lösung, denn diese Kreuzung direkt am Marathonhotel müssen sie nicht überwachen und können die Strecke dennoch auf der diagonal gegenüberliegenden Ecke weiter führen. Zumindest auf der langen Distanz. Denn während oben das rote Schild nach rechts zeigt, deutet der gelbe Pfeil geradeaus. Die am See zusammen geführten Kurse laufen also schon wieder auseinander.
Auch am Boden sind mit Kreide wieder Richtungspfeile abgestreut. Doch diese sich teilenden Marken zeigen eine im ersten Augenblick seltsame Beschriftung. Während beim einen nämlich "1/2" neben der Spitze steht, ist vor dem anderen ein "H" zu lesen. Das könnte "Halv" heißen, würde dann aber irgendwie nicht zu den restlichen Zeichen passen.
Gemeint ist vielmehr der "Helmaraton", wohinter sich in Norwegen eine zweiundvierzig Kilometer lange Distanz verbirgt. Denn "hel" lässt sich eben als "voll" entschlüsseln. Mit etwas Fantasie kann man dem Wörtchen schließlich auch die Verwandtschaft zum deutschen "heil" im Sinne von "ganz" ansehen. Auch bei "halv" und "hel" sind sich die Skandinavier, deren Sprachen nicht wirklich weiter auseinander liegen als nord- und süddeutsche Dialekte, übrigens wieder einmal einig.
Der doch eher ungewohnte Anblick von mehreren Wohnblöcken an der nun angesteuerten Kreuzungsecke wird schnell wieder durch die bekannten Einfamilienhäuser ersetzt, als der Marathonkurs für einen kleinen Ausflug nach Norden auf den Radweg neben der Hauptverbindungsstraße nach Bergen einschwenkt.
Ihre Kennzeichnung "E39" macht klar, dass es sich formal um eine Europastraße handelt, die nach einer langen Fährpassage in Dänemark noch eine Fortsetzung hat. Während man praktisch überall sonst auf dem Kontinent von diesem Netz kaum Notiz nimmt und eigentlich nur die jeweiligen nationalen Nummerierungen kennt, benutzt man für Fernverbindungen in Norwegen und Schweden falls vorhanden einzig und alleine das internationale System.
Bekannteste dieser Straßen dürfte wohl die manchmal als "Nordkaprennstrecke" verspottete E6 sein, die sich von der Südspitze Schwedens mehr als dreitausend Kilometer durch ganz Skandinavien zieht. Tausende von Fahrzeugen mit ausländischen - vorrangig deutschen - Kennzeichen rollen im kurzen nordischen Sommer auf ihr nach Norden.
 |
 |
| Nachdem man den See bei Kilometer elf endgültig verlässt … | … bringt ein zweistöckiger Verkehrskreisel die Läufer kreuzungsfrei über eine Hauptstraße |
Neben dem Fjordland ist der nördlichste mit dem Auto erreichbare Punkt Europas - was wohl die Umschreibung für das Nordkap ist, der man am wenigsten widersprechen kann, denn selbst auf der gleichen Insel gibt es bereits eine noch weiter in Richtung Pol ausgreifende Landzunge - das zweite wichtige Ziel des jährlichen Touristenzuges nach Norwegen.
Doch sollte man die Distanzen dabei nicht unterschätzen. Denn selbst wer aus Süddeutschland stammt, also neben Dänemark und Schweden auch schon das eigene Heimatland vollständig durchqueren muss, hat mit dem Überschreiten der norwegischen Grenze noch nicht einmal die Hälfte der Wegstrecke geschafft.
Die Fjorde des Westlandes sind da wenigstens etwas näher. Doch auch dort ist die Saison zum Zeitpunkt des Stavanger Marathons Ende August beinahe schon vorbei. Die Zahl der Wohnmobile und Rundfahrtbusse scheint jedenfalls bereits deutlich geringer zu sein als im Juni und Juli, wenn die Tage am längsten und die Nächte so kurz sind, dass es kaum richtig dunkel wird.
Bis kurz vor die Markierung mit der "13" hält sich die Strecke für ungefähr einen Kilometer an die Hauptstraße, bevor sie erneut in ein dem äußeren Anschein nach noch nicht allzu lange bestehendes Wohngebiet abdreht. Doch nicht allzu lange hält sie sich dort auf. Denn mit dem Abschluss des ersten Drittels lässt der Kurs alles Städtische vorerst hinter sich. Der Marathon wandelt sich für einige Zeit zu einem echten Landschaftslauf.
Durch ein kleines Wäldchen geht es zum nächsten See, dem gegenüber dem Mosvatn noch einmal deutlich größeren Store Stokkavatn. Der Abzweig ist eine der wenigen Stellen, an denen man dann doch ein wenig unsicher über den weiteren Streckenverlauf werden kann. Nicht geradeaus weiter auf dem Asphalt sondern in den wieder mit feinem Schotter belegten Uferweg hinein muss man nämlich laufen.
Und eine - am Vortag vielleicht sogar noch vorhandene - Bodenmarkierung kann man nach dem nächtlichen Regen nicht entdecken. Auch keines der roten Täfelchen mit Richtungspfeil lässt sich sehen. So bleiben nur noch die Flatterbänder, die zusätzlich an Bäumen, Büschen oder Verkehrsschildern angebracht sind und zwischendurch immer wieder signalisieren, wo es weitergeht und ob man noch richtig ist.
Auch John Nessa ist sich nicht sicher. Dabei sollte er die Strecke doch eigentlich kennen, schließlich startet er doch für den Ausrichter GTI. Doch schon vorher hatte der Zweiundsechzigjährige in ziemlich gutem Deutsch erzählt, dass er nicht in der Stadt selbst sondern "in den Bergen" wohne.
Genau genommen kommt es aus Hjelmeland, einer Kommune, die sich rings um den Jøsenfjord - ein weiterer Seitenarm des Boknafjordes dreißig Kilometer nordöstlich von Stavanger - ausdehnt. Deren höchste Stellen liegen tatsächlich weit oberhalb von tausend Meter und damit deutlich über der Baumgrenze.
Durch sie hindurch führt der "Riksveg 13", eine der vielleicht für Touristen interessantesten Straßen im Fjordland, die in Stavanger beginnt, zuerst entlang des Boknafjords, dann durch Landesinnere hinüber zum Hardanger- und schließlich auch noch zum Sognefjord führt und dabei einen spektakulären Querschnitt durch praktisch sämtliche Landschaftsformen Norwegens bietet.
"Ryfylkevgen" nennt man diese Straße in ihrem südlichen Teil nach der Gegend, durch die sie sich in diesem Abschnitt windet. Administrativ haben diese "Distrikte" zwar eigentlich längst keine Bedeutung mehr, doch stiften sie gerade im zerklüfteten Westen des Landes jeweils eine eigene regionale Identität. Aufgrund der Unwegsamkeit haben sich in den unzähligen Tälern und entlang der vielen Fjorde schließlich manchmal völlig unterschiedliche Traditionen und Dialekte heraus gebildet.
 |
 |
| Stokkavatnet heißt der zweite See, der beim Marathon umrundet wird | |
Und obwohl das bis ins Hochgebirge hinauf reichende Ryfylke mit dem flachen Jæren in der Provinz Rogaland zusammen gefasst ist, ergeben sich schon aus den völlig unterschiedlichen topographischen Voraussetzungen eher wenige Gemeinsamkeiten. Auch Haugaland im Nordwesten und Dalane im Südosten, die ebenfalls noch zur auf Norwegisch "Fylke" genannten Verwaltungseinheit gehören, haben einen jeweils etwas anderen Charakter.
Neben Rogaland - benannt nach dem einst dort siedelnden Stamm der Rugier - im Süden besteht Vestlandet dann noch aus der Provinz Hordaland mit Bergen und dem Hardangerfjord, dem vom Sogne- bis zum Nordfjord reichenden Sogn og Fjordane sowie als nördlichen Abschluss dem Fylke Møre og Romsdal, die sich ihrerseits aus insgesamt elf weiteren "distrikter" zusammen setzen.
Fast sechs Kilometer lang führt der Weg immer in Sichtweite des Stokkavatn meist durch Wald, gelegentlich auch einmal kurz über eine Wiese. Nicht einmal eine Handvoll Kilometer ist man vom Zentrum der am dichtesten bebauten Gemeinde in ganz Norwegen entfernt und dennoch hat man das Gefühl, sich mitten in einem Feriengebiet zu befinden.
Während norwegische Läufer in kleinen Ortschaften sicher ziemliche Mühe haben geeignete Strecken abseits der Hauptstraße zu finden, können sie sich in Stavanger nun wahrlich nicht beschweren. Die beiden Runden um die Seen lassen jedenfalls für kaum eine Leistungsklasse zwischen Gelegenheitsjogger und Leistungssportler einen Wunsch offen, zumal sie sich auch noch mit Uferwegen einiger anderer Wasserflächen erweitern ließen.
Ziemlich genau am nördlichsten Ende des immerhin zwei Quadratkilometer großen Sees ist die nächste Verpflegungsstelle aufgebaut. Man kann sich nun trefflich darüber streiten, ob es erst die zweite oder schon die vierte ist. Weitere sechs werden jedenfalls bis zum Ziel noch folgen, solide bestückt mit Wasser, Elektolytgetränken, Bananen und zu Schluss auch Cola.
Und mit jeweils etwa einem halben Dutzend Helfer sind alle angesichts der nicht wirklich großen Felder absolut ausreichend besetzt. Doch so ganz wird man sich später des Eindrucks nicht erwehren können, dass man einige der am letzten Versorgungspunkt Becher reichenden Jugendlichen unterwegs schon einmal an einem anderen Posten, nämlich am Stokkavatn, gesehen hat.
War die erste Hälfte der Schleife um den See nahezu völlig eben, bauen sich beim Rückweg auf der gegenüberliegenden Seite gleich mehrfach kurze, aber ziemlich steile Hügel vor den Marathonis auf. Fünf, acht, maximal zehn Meter sind dabei zu überwinden, diese allerdings in satt zweistelligen Prozentwerten. Jedes Mal schießt dabei eine hohe Dosis Milchsäure in die Beinmuskulatur.
Ganz so flach wie Geir Sveen gehofft hatte, ist die Strecke also doch nicht. Und der Skilangläufer mit Zweitsportart Marathon bekommt in diesem Abschnitt auch bereits erste Probleme. Es hat nicht unbedingt seinen besten Tag. Mit der Zeit unter vier Stunden wird es wohl nichts, das ist ihm schon lange vor der Halbzeitmarke klar. Am Ende wird er 4:34:25 benötigen und damit deutlich langsamer als bei seinen besten Marathons in den Bergen am anderen Ende des Fjords sein.
Der letzte Teil der Seerunde führt die Läufer mitten durch einen an den Store Stokkavatn angrenzenden Golfplatz. Es herrscht bereits ein gewisser Betrieb auf den Grüns. Und das gelegentlich zu hörende Geräusch von Abschlägen macht beim Gedanken an die Härte von Golfbällen keinen wirklich vertrauenserweckenden Eindruck. Doch ist der Weg ja öffentlich, er wird also nicht mitten durch die Hauptflugrichtungen geführt worden sein. Man muss eben darauf hoffen, dass alle ihr Sportgerät einigermaßen beherrschen.
Als das südliche Ende des Sees erreicht ist, schwenkt die Marathonstrecke auf einen Wasserlauf als Begleiter um. Auch hinter der nächsten Verpflegungsstelle unter der Straßenbrücke, vor der die Senke des Baches überspannt wird, orientiert sie sich noch ein ganzes Stück weiter an ihm und dem dazu gehörenden Grünstreifen. In nun nicht mehr ganz so ländlicher Umgebung, aber immer noch unter Bäumen wird die erste Hälfte der Distanz abgeschlossen.
Schon mehrfach sei er in Berlin gelaufen, berichtet John Nessa. Auch in Kopenhagen sei er zum Beispiel bereits gewesen. Und den Swiss Alpine in Davos habe er auch schon mitgemacht, allerdings in diesem Jahr nicht die ganz lange Strecke sondern nur den leichteren der beiden dortigen Marathons absolviert.
Selbst wenn man öfter einmal in Skandinavien unterwegs ist, sind die guten Fremdsprachenkenntnisse der Nordländer dennoch immer wieder überraschend, denn das Deutsch des hochgewachsenen Seniors, der bei den Meldungen zu seinen Wettkämpfen auf seinen eigentlich vorhandenen Doktortitel meist nicht den geringsten Wert legt, ist bei diesen Aussagen zwar nicht völlig fehlerfrei aber trotzdem absolut flüssig.
Englisch, das bereits ab dem ersten Schuljahr unterrichtet wird, beherrschen sowieso fast alle. Und zwar ziemlich gut und praktisch ohne erkennbaren Akzent. Doch eine oder zwei weitere Sprachen, meist die ebenfalls in der Schule angebotenen Deutsch, Französisch oder Spanisch haben viele in zumindest brauchbarer Form eben auch noch auf Lager.
Manchmal ist es fast schon ein wenig beschämend. Wenn Nessa beim Gespräch im Laufdress nämlich die Anrede "Sie" anstelle des in seiner Muttersprache - und eben auch unter deutschsprachigen Sportlern meist üblichen - "Du" benutzt, zeigt wohl zum einen, dass er nicht nur die fremden Vokabeln sondern auch die etwas anderen Konzepte verinnerlicht hat, und zum anderen seine Höflichkeit.
Natürlich spielen da nicht synchronisierte sondern nur mit Untertitel versehene Filme und Fernsehsendungen eine Rolle, die ständig neues Übungsmaterial liefern. Doch auch die Tatsache, dass man als kleines Volk von nicht einmal fünf Millionen Menschen eben nicht erwarten kann, überall verstanden zu werden, lässt das Interesse anwachsen.
Das ist ein wohltuender Kontrast zum manchmal doch fast schon an Arroganz grenzenden Auftreten vieler Angelsachsen, die sich selbst bei längeren Auslandsaufenthalten nicht einmal die Mühe machen, Wörter wie "bitte" und "danke" in anderen Sprachen zu lernen. Und gerade weil man das bei Englischsprachigen selbst so empfinden kann, ist es klar, wie gut es im umgekehrten Fall ankommt, wenn man einem Norwegen gegenüber ein paar norwegische Brocken beherrscht.
So schwer sei Norsk nicht, behauptet Nessa, insbesondere die Grammatik sei deutlich einfacher als im Deutschen. Alle seine deutschen Freunde und Bekannten in Norwegen - in der Tat begegnet man auch als Tourist immer wieder einmal im nordischen Königreich lebenden und arbeitenden Landsleuten - hätten es relativ schnell gelernt.
Mit ein bisschen Interesse findet man sich selbst als Besucher tatsächlich bald ganz gut zurecht. Die Verwandtschaft mit dem Deutschen und auch dem Englischen hilft dabei doch erheblich. Wenn es natürlich auch für komplizierte Fachliteratur nicht reicht, kann man zumindest die wichtigsten Dinge durchaus lesen.
 |
 |
| In der Nähe des Fußballstadions von Viking Stavanger … | … erreicht man nun auf der anderen Seite der Halbinsel wieder das Meer |
Beim gesprochenen Wort ist das aufgrund der vielen recht verschiedenen Dialekte - deren Verwendung bei weitem nicht so verpönt ist wie hierzulande, sogar in der Politik, in großen Unternehmen oder an Universitäten sind sie weit verbreitet - und einiger vom Schriftbild doch etwas abweichender Aussprachen allerdings zugegebenermaßen am Anfang nicht ganz so einfach.
Im Fjordland, das durch das Hochgebirge jahrhundertelang praktisch vom Osten Norwegens abgeschnitten war, redet man also mehr als nur ein wenig anders als in der Hauptstadt Oslo. Die westlichen Dialekte sind Isländisch und Färöisch, mit denen sie eine gemeinsame Wurzel teilen, jedenfalls noch deutlich näher als die mehr in Richtung Schwedisch tendierenden Mundarten jenseits der Berge.
Manchmal schreibt man in Vestlandet sogar anders als in der Hauptstadt. Denn trotz der eher kleinen Zahl an Sprechern existieren zwei ziemlich unterschiedliche Schriftvarianten des Norwegischen. Die eine heißt "Bokmål", die andere nennt sich "Nynorsk". Beide haben offiziellen Charakter und ihre Existenz führt immer wieder einmal auch zu Reibereien.
Während Bokmål, die "Buchsprache", sich mehr an das Dänische anlehnt, das aufgrund der langen Herrschaft der Könige von Dänemark über Norwegen in der Verwaltung dominierte, ist Nynorsk als eine Art künstliches Dach aus den urtümlicheren Dialekten im Fjordland entwickelt worden. Eigentlich ist "Neunorwegisch" also eher älter.
Jede Kommune im Land kann entscheiden, ob sie nur eine von beiden Varianten im Schriftverkehr zulässt oder beide. Im Osten und Norden dominiert Bokmål als Amtssprache, im Westen dagegen wenig überraschend eher Nynorsk. Jeweils ungefähr ein Drittel der norwegischen Gemeinden legen sich in eine Richtung fest. Das letzte Drittel gilt als "nøytral" und findet sich auch hauptsächlich in der Mitte.
Was sich nach Gleichgewicht anhört, ist bei genauerer Betrachtung aber eine klare Bokmål -Dominanz. Denn bezogen auf die Bevölkerung schreiben weniger als zwanzig Prozent Nynorsk, das in nämlich den eher dünn besiedelten Regionen benutzt wird. Die "Buchsprache" dagegen herrscht in den Städten vor. Auch Stavanger hat sich obwohl man rundherum eher Neunorwegisch bevorzugt, für Bokmål entschieden.
 |
 |
| Auf dem letzten Kilometern hat man die norwegischen Berge fast ständig direkt vor Augen | |
Der geschotterte Spazier- und Radweg entlang des Baches endet an einer Straße, die dem Marathonkurs von nun an die Richtung vorgibt. Zwei junge Männer mit gelben Leuchtwesten über einer feldgrünen Uniform sichern die Einmündung direkt dahinter ab. Nicht zum ersten Mal begegnet man während des Laufes Militärangehörigen. Sie haben vielmehr sogar den kompletten Ordnungsdienst entlang der Strecke übernommen.
Diese beiden jungen Burschen haben aber von all den Rekruten von Marine - denn auch dunkelblaues Tuch bekommt man zu sehen - und Armee, die da für die Marathonis im Einsatz sind, wohl den wirklich kürzesten Weg zu ihrer Position gehabt. Denn die Seitenstraße endet nach wenigen Metern am Tor einer Kaserne.
Gerade einmal zwanzigtausend Soldaten ist "Forsvaret" - was sowohl "Verteidigung" als auch die norwegischen Streitkräfte meint - stark. Eigentlich besteht noch eine Wehrpflicht für alle männlichen Norweger. Doch einer der uniformierten Helfer wird später erzählen, dass "only one out of six" wirklich einrücken müsse. Und so seien nicht nur alle Frauen - auch diese sieht man unterwegs nämlich im Tarnanzug stehen - sondern auch viele der Männer Freiwillige.
Eigentlich habe er sogar selbst mitmachen wollen, und zwar auf der langen Distanz. Halbmarathon wäre er immerhin schon gelaufen. Doch da er jetzt bei der Marine sei und auf einem Schiff Dienst tue, hätte er einfach nicht die nötigen Trainingsmöglichkeiten. Der Marathon sei für sie alle jedenfalls eine willkommene Abwechslung. Und mancher belässt es dann auch nicht nur beim Verkehr regeln oder Richtung anzeigen, sondern übernimmt auch mit viel Euphorie die Rolle des ansonsten nicht gerade zahlreich vorhandenen Publikums.
Nach Harald Hårfagre ist die Kaserne benannt, jener König dessen Namen übersetzt "Harald Schönhaar" bedeutet und mit dem das norwegische Kernland im neunten Jahrhundert erstmals unter einem gemeinsamen Herrscher vereint war. Ansonsten ist allerdings eher wenig über ihn bekannt, da wirklich verlässliche historische Quellen weitgehend fehlen und die meisten, zum Teil auch widersprüchlichen Informationen aus mittelalterlichen Sagas stammen.
Doch besser als an dieser Stelle könnte ein so heißender Stützpunkt kaum liegen. Denn nur wenige Schritte darauf trägt eines jener braunen Schilder, mit denen man gerne Sehenswürdigkeiten markiert, die Aufschrift "Sverd i fjell". Drei gigantische Schwerter scheinen dort jenseits des Parkplatzes tatsächlich tief in einem Fels zu stecken. Sie erinnern an das vermutlich dort geschlagene entscheidende Gefecht, bei der Harald seine wichtigsten Gegenspieler besiegte.
 |
 |
| Zwischen Bahnlinie und Fjord verläuft die Strecke kilometerlang direkt am Ufer entlang | |
Zwischen 868 und 875 datiert man diese "Schlacht am Hafrsfjord" inzwischen. Ganz sicher kann man dabei natürlich nicht sein, denn auch über diesen Kampf gibt es nur vage Unterlagen. Doch in der Kombination aller verfügbaren Informationen glaubt man sie so weit eingrenzen zu können. Zu den Quellen zählt auch das isländische Landnámabók, eine Art Einwanderungschronik Islands, wohin einige der Unterlegenen flüchteten. Andere der Besiegten brachen in Richtung Färöer auf. Auch darüber gibt es Berichte in den Sagas.
Der Hafrsfjord, jene Wasserfläche, die man hinter der Kaserne erreicht hat und deren Ufer sowohl die Straße wie auch der Radweg folgt, scheint dagegen als Ort ziemlich festzustehen. Ja, das sei tatsächlich der Atlantik und nicht etwa ein weiterer See, bestätigt einer der Mitläufer auf Englisch, denn eigentlich wirkt es überhaupt nicht so. Das Wasser sei trotzdem "salty".
Nicht nur weil die Umgebung ziemlich flach ist, hat der Hafrsfjord keineswegs das Aussehen eines klassischen Fjordes. Auch auf der Karte hat er nicht die typische längliche Form, vielmehr erinnert er an einen Hammer, dessen Stiel ist die Verbindung zum offenen Meer darstellt. Da diese schmale Öffnung von der Laufstrecke gar nicht zu sehen ist, gibt es abgesehen von dem etwas erhöhten Wellengang kein echtes Indiz, dass es sich um einen Fjord handeln könnte.
Doch wurde mit diesem Wort eigentlich ursprünglich jede weit ins Land hinein reichende Bucht versehen. Das ähnlich verwendete englischen "Firth" und die deutsche "Förde" können die Ähnlichkeit nun wahrlich nicht verleugnen. Auch enge Fahrwasser zwischen zwei Inseln wurden so bezeichnet. Die deutlich eingeschränktere Definition der Geologen entstand erst viel später, als man die Entstehung der norwegischen Musterbeispiele dieser Gattung verstanden hatte.
"Atlanterhavet" ist nun für zwei Kilometer der Begleiter der Marathonis. Oft, aber eben doch nicht immer hilft die Suche nach Analogien beim Verständnis des Norwegischen weiter. Manchmal sorgt es eher für Verwirrung. Denn "Hav" hat absolut nichts mit "Hafen" zu tun, es bedeutet "Ozean".
Obwohl noch eine andere Kommune die Nordspitze einnimmt, liegt Stavanger im oberen Teil einer Halbinsel. An beiden Seiten besitzt die Stadt einen Anteil an deren Küste. Im Westen grenzt sie an den Atlantik und im Osten an die südlichen Seitenarme des Boknafjordes. Nur wenige Kilometer nördlich öffnet sich dieser zum Ozean hin. Insbesondere dieser Fjord beginnt also tatsächlich mehr oder weniger direkt in Stavanger.
Nur im Süden hat die Region richtigen Kontakt zum Festland, nur dort kann man die Stadt also über die Straße erreichen. Die Verbindungen nach Osten und Norden stellen dagegen Fähren her, die in Fjordnorwegen weiterhin ein vollkommen normales Verkehrsmittel sind. Die Wartepausen an den Anlegern gehören für Skandinavienfreunde genauso zum Urlaub wie die herrlichen Aussichten von den oberen Decks während der meist kaum halbstündigen Überfahrt.
Für den Verkehr im Land selbst stellen sie bei aller Attraktivität jedoch immer wieder ein erhebliches Hindernis dar. Genau wie die kurvigen Pässe durch die hochgelegenen Fjellregionen, die im Winter oft viele Monate wegen Schnee gesperrt werden müssen und auch im Sommer einiges an Gekurbel verursachen.
Und so schlagen die norwegischen Ingenieure inzwischen an möglichst schmalen Stellen durchaus auch Brücken über den einen oder anderen Fjord oder zwischen den unzähligen Inseln vor der Küste. Über das hintere Ende des Hardangerfjord wird zum Beispiel gerade eine fertig gestellt, mit der in naher Zukunft eine zweite fährfreie Fernverbindung zwischen den beiden norwegischen Zentren Bergen und Oslo bestehen soll.
Noch viel häufiger sprengen und bohren sich die Straßenbauer allerdings einfach durch den Fels. Tausende, vielleicht sogar zehntausende Kilometer Tunnel durchziehen das Land. Vom wenige Meter langen Bogen unter einer Felsnase hindurch bis zum rund fünfundzwanzig Kilometer langen Lærdaltunnel. Übertrieben gesagt ist Norwegen löchrig wie ein Schweizer Käse.
Drei, fünf oder sieben Kilometer lange Passagen unter der Erde sind gerade auf den Hauptverkehrsstrecken absolut nichts besonderes. Gelegentlich kann man nur wenige Sekunden Licht tanken bevor man wieder für Minuten im nächsten Loch verschwindet. Wer klaustrophobisch veranlagt ist, wird auf Norwegens Straßen vermutlich nicht unbedingt glücklich.
 |
 |
 |
| Als letzter See wird kurz vor dem Ziel noch Breiavatnet passiert | ||
Und nicht nur durch Berge hat man sich gearbeitet. Nur wenige Fahrminuten von Stavanger entfernt versinkt die E39 gleich zweimal kurz hintereinander unter dem Meer, um sich erst einmal über einige Inseln weiter nach Norden vorzuarbeiten und damit die Zeit auf der Fähre zu verkürzen. Mehr als zweihundert Meter geht es im tieferen von beiden Tunneln hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf.
Dass solche Lösungen zwar im vorderen, ozeannahen, nicht aber im hinteren Bereich der Fjorde möglich sind, mag überraschen. Doch im Landesinneren haben sich die Gletscher viel tiefer ins Gestein hinein gegraben. Es sind im ersten Moment kaum vorstellbare Werte, die da zu lesen sind. Der Sognefjord als Rekordhalter reicht an seiner tiefsten Stelle nämlich volle vierzehnhundert Meter nach unten.
Inzwischen stehen auch erneut gelbe Schilder am Straßenrand. Denn die fast vier Kilometer zwischen Verpflegungsstelle fünf und sechs und damit der Abschnitt am Hafrsfjord gehören wieder zu beiden Strecken. Den großen Bogen, den der Marathon nach Norden um das Stokkavatn geschlagen hat, werden sich die Halbmarathonis später schenken und auf dem direkten Weg herüber kommen. Darum haben sie gerade einmal Halbzeit, als sich beide Kurse bei Marathonkilometer vierundzwanzig wieder teilen.
Noch ein anderes, wesentlich größeres Schild hatte ebenfalls an der Straße gestanden. Es begrüßte die Läufer in der Kommune Sola. Nicht die gesamte Strecke wird also im Stadtgebiet von Stavanger zurück gelegt. Zumindest kann man das so sehen, wenn man die rein administrative Brille aufgezogen hat.
Da jedoch sowohl einige Teile von Sola wie auch fast die komplette südliche Nachbarstadt Sandnes mit Stavanger vollkommen verwachsen sind, könnte man dieses zusammen hängende Gebiet natürlich genauso gut absolut unabhängig von eigentlich willkürlichen Grenzziehungen als eine einzige Großstadt ansehen.
Die vermeintlich leichte Frage "wie groß ist eine Stadt" lässt sich nämlich in Wahrheit gar nicht so leicht beantworten. Um angesichts international absolut unterschiedlicher Auffassungen bezüglich des Zuschnittes einer politischen Gemeinde überhaupt eine gewisse Vergleichbarkeit hin zu bekommen, wird bei länderübergreifenden Erwägung in der Regel nämlich eine Betrachtung geschlossener Besiedlungsgebiete gemacht. In Norwegen gibt es für solche Siedlungskerne sogar einen Begriff, er lautet "Tettsted", was ungefähr mit "dicht besiedelter Stelle" übersetzt werden kann.
Wie im Falle Stavanger kann sich dieses auf mehrere Kommunen ausdehnen. Für Oslo gilt das zum Beispiel genauso, nicht jedoch für Bergen oder Trondheim, die mit dem Besiedlungskern innerhalb der eigenen Grenzen bleiben. Umgekehrt hat eine großräumige Gemeinde aber eben auch etliche Tettsteder, jedes der weit verstreuten, viele Kilometer auseinander liegenden Dörfer ist nämlich eine.
Røyneberg, auf das die Marathonstrecke nun ein wenig entfernt vom gar nicht nach Fjord aussehenden Fjord zusteuert, ist dagegen zwar ein Ortsteil von Sola, gehört aber dennoch zum Tettsted "Stavanger/Sandnes". Inzwischen ist man - wieder überwacht von Rekruten mit Leuchtwesten - auf die linke Straßenseite gewechselt, allerdings weiterhin auf dem Radweg unterwegs.
 |
 |
 |
| Die halbe Runde um den kleinen Stadtsee müssen sich die Läufer mit Spaziergängern teilen | ||
So ist es dann auch relativ leicht, noch weiter nach links abzudrehen und das Dorf gleich wieder zu verlassen, bevor man es überhaupt richtig betreten hat. Anfangs ist es ein kleiner Feldweg durchs Grüne, später eher eine Baustelle, die hinüber in ein an dieser Stelle anscheinend noch wachsendes Gewerbegebiet führt, in dem man das zweite Drittel der Distanz abschließt.
Wo der kurze Ausflug nach Sola endet und man wieder den Boden der Kommune Stavanger betritt, wird nicht klar. Doch der "Forus Næringspark", der "Forus Gewerbepark" liegt zwar rund um den Punkt, an dem sich die drei Gemeinden berühren, jedoch größtenteils im Stadtgebiet von Stavanger. Auf Bürgersteigen und Radwegen wird das wie eigentlich alle seine Artgenossen nur bedingt sehenswerte Gelände von den Marathonis durchquert.
Den Weg müssen sie dabei oft selbst finden, denn Streckenposten sucht man auf diesem Abschnitt meist ziemlich vergeblich. Bei weitem nicht jede Einmündung von Querstraßen ist durch einen Helfer bewacht. Angesichts von nur gut einhundert Teilnehmern ist das auch weder möglich noch nötig. Doch die an fast jedem verfügbaren Pfosten angebrachten Flatterbänder lassen dennoch selten Zweifel über die einzuschlagende Richtung aufkommen.
An einem Kreisel schwenkt der Kurs im rechten Winkel auf eine Hauptzufahrtsstraße des Industriegebiets ein, genauer gesagt natürlich wieder nur auf den parallel verlaufenden Fuß- und Radweg. Abgesehen von einigen kleinen Wohnstraßen ist die Strecke, selbst wenn sie größtenteils durch dicht bebautes Gebiet führt, tatsächlich praktisch verkehrsfrei angelegt. Wo viel befahrene Verkehrswege gekreuzt werden müssen, haben die Kurssetzer immer irgendwo eine Brücke oder einen Fußgängertunnel gefunden.
Dass dies bei der Autobahnquerung wenig später nötig ist, kann man natürlich als Selbstverständlichkeit ansehen. Weit weniger selbstverständlich für Norwegen ist diese mehrspurige Piste selbst. Denn angesehen von den Ballungsräumen gibt es im Land kaum Schnellstraßen in diesem Ausbaugrad. Nur die Nord-Süd-Hauptachse E6 ist bisher in längeren Abschnitten zu einem echten "Motorvei" erweitert.
Selbst die wichtigsten Verbindungsstrecken haben ansonsten selten mehr als Landstraßencharakter. Doch andererseits ist im dünn besiedelten Norwegen viel mehr eigentlich auch gar nicht nötig. Gerade im Fjordland muss man sich manchmal sowieso schon darüber wundern, wie man in dieser Landschaft überhaupt zwei Fahrspuren unterbringen kann. Wie sollte das mit vier oder sechs gehen? Und wegen der strikten Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf Autobahnen macht es ohnehin kaum einen Unterschied.
Zwar werden aus den Hallen und Bürogebäuden am Straßenrand nach und nach wieder hauptsächlich Wohnhäuser. Doch ansonsten ändert sich am Charakter der Strecke im Stadtteil Forus eher wenig. "Unspektakulär" ist eine neutrale Umschreibung für eine Passage, die sich bei einem Marathon in Städten dieser Größenordnung wohl einfach nicht vermeiden lässt. Wer einen oder mehrere der am Anfang aufgezählten deutschen Läufe kennt, wird das durchaus bestätigen können. Einzig die Trabrennbahn der Stadt bringt ein wenig Abwechslung.
Inzwischen ist der Kurs wieder nach Norden abgedreht. Und mehrere kleine Kuppen widerlegen endgültig Geir Sveens Behauptung, das sei ein ziemlich flacher Marathon. Nicht nur wegen vieler Ecken und des etwa zur Hälfte aus Schotter bestehenden Untergrundes hat Stavanger wohl nicht das Zeug zu einer echten Rekordpiste.
 |
 |
 |
| Der See und sein kleiner Park liegen mitten im Stadtzentrum von Stavanger | ||
Dass ausgerechnet in dieser Phase zwischen den ansonsten eigentlich ziemlich dicht gesetzten Getränkestellen eine mehr als fünf Kilometer weite Lücke klafft, kommt erschwerend hinzu. Da erscheinen die immer wieder auftauchenden Kreisel - die Norweger haben eine gewisse Vorliebe für den Bau eines "Rundkjøring" - fast wie eine Schikane. Denn obwohl man geradeaus die Markierungsbänder auf der anderen Seite schon flattern sieht, muss man gelegentlich ziemlich weit ausholen, um den dazu gehörenden Zebrastreifen zu erreichen.
Die letzten zehn Kilometer sind gerade angebrochen, als die Marathonstrecke sich an einer Unterführung endgültig vom Radweg verabschiedet und die Seiten wechselt. Der "Sti", der dort von der Straße wegführt, verschwindet keine zweihundert Meter später in einem weiteren kurzen Tunnel. Diesmal geht es unter einer Bahnlinie hindurch.
Von Süden her, also der einzigen Richtung, aus der es überhaupt möglich ist, steuert die "Sørlandsbane" auf Stavanger zu. Sechshundert Kilometer windet sich die "Südlandbahn" die Küste entlang, bis sie fast am anderen Ende des Landes schließlich Oslo erreicht. "Stavanger stasjon" im Stadtzentrum ist der zweite Endbahnhof dieser Strecke. Mehr Schienenverkehr außer dieser Linie gibt es in der Region im Südwesten Norwegens nicht. Fjorde und Berge haben etwas dagegen.
Mehr noch als bei den Straßen stellen sie für die Eisenbahn, die deutlich weniger Steigung verkraften kann und größere Wendekreise braucht, ein nahezu unüberwindbares Hindernis dar. Einzig die viel gerühmte und als technisches Meisterwerk geltende Bergenbahn quert nördlich von Stavanger wirklich den Fjell und verbindet damit die beiden größten Städte des Landes.
Ansonsten stößt im ohnehin dünnen Netz der norwegischen Staatsbahn nur noch die Raumabahn in der nördlichsten Vestland-Provinz Møre og Romsdal ins Fjordland vor. Der größte Teil des öffentlichen Transportwesens in dieser Region wird jedoch mit Bussen abgewickelt. Unter dem auch im Deutschen durchaus verständlichen "Kystbussen" firmiert zum Beispiel die Express-Verbindung zwischen Bergen und Stavanger.
Direkt hinter der Bahnlinie taucht das bereits am Start angekündigte Fußballstadion von Viking Stavanger vor den Läufern auf. Neben Rekordmeister Rosenborg Trondheim sind die Wikinger vielleicht der einzige Club der norwegischen "Eliteserien", der hierzulande überhaupt einigermaßen ein Begriff ist. Nach den Arenen in Oslo und Trondheim sowie dem nur unwesentlich größeren Stadion in Bergen belegt Stavanger mit dem erst vor wenigen Jahren eingeweihten Neubau auch in der Rangliste über die Zuschauerkapazität wie üblich wieder einmal Rang vier.
Ein kleiner Schlenker bringt die Läufer nun erstmals auch auf der östlichen Seite der Halbinsel von Stavanger ganz kurz ans Wasser. Ein Rekrut winkt in ein Sträßchen nach rechts. Allerdings sind trotz des Abbiegens nur etwa hundert Meter hinter ihm bereits wieder die nächsten uniformierten Streckenposten sichtbar. So ist klar, dass man unweit dieser Ecke bald wieder vorbei kommen wird. Und tatsächlich braucht man nur wenige Minuten, um trotz des kleinen Umweges dorthin zu gelangen.
Nachdem man das Viking-Stadion, diesmal auf der Rückseite erneut kurz gestreift hat, wird die Strecke deutlich belebter. Denn ziemlich genau mit Kilometer fünfunddreißig stoßen an einer Verpflegungsstelle die Halbmarathonläufer, die ihre zwei Stunden Startrückstand zu diesem Zeitpunkt wegen der deutlich kürzeren Distanz aufgeholt haben, dazu. Wenig später ist auch das Werftgelände, das den Weg - wieder einmal eine markierte Radstrecke - vom Wasser abgetrennt und die Sicht versperrte, passiert.
 |
 |
| Mit Kilometer 42 beginnt am Breiavatn der Endspurt | |
Der größte Teil des letzten Marathonsechstels wird von nun ab mehr oder weniger direkt am Gandsfjord entlang gelaufen. Die Bahnlinie auf der linken, das Meer auf der rechten Seite bleiben für die inzwischen asphaltierte Radpiste gerade einmal zwei Meter. Dafür kann der Blick vollkommen frei über den Fjord hinüber zu den Bergen auf dem gegenüber liegenden Ufer wandern.
Steil, schroff und kahl erheben sie sich dort, gerade so als ob sie dem ausländischen Besucher die ersten Zeilen der norwegischen Nationalhymne nahe bringen. "Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet" lauten sie. "Ja, wir lieben dieses Land, wie es hervor steigt, zerfurcht, wettergegerbt aus dem Wasser". Viel treffender kann man es in wenigen Worten wohl kaum beschreiben.
Und den innigen Bezug der Norweger zu ihrem Land kann man mehr als nur erahnen. An die überall an den Masten wehenden Nationalfahnen oder -wimpel - diese sind eigentlich noch beliebter, denn im Gegensatz zu einer echten Flagge müssen sie laut einer gesetzlichen Regelung nachts nicht eingeholt werden sondern dürfen hängen bleiben - hat man sich als Besucher bald gewöhnt.
Auch die wenigen Zuschauer, die an der Marathonstrecke die Läufer anfeuern, tun dies oft mit kleinen Fähnchen in der Hand. Wenn dann bei nordischen Skiwettbewerben Zigtausende zusammen kommen, wandelt sich das schnell zu einem regelrechten Meer in rød, hvit und blå. Selbst das Band der Medaille im Ziel des Stavanger Marathons ist ja in diesen Farben gehalten. Doch eigentlich bedeutet das keine echte Überraschung. Das gibt es nämlich bei den meisten Laufveranstaltungen im Land.
Mit Hurra-Patriotismus oder der überheblichen Einstellung "wir sind sowieso die Größten", den man bei einigen anderen Staaten begegnet, hat das allerdings ziemlich wenig zu tun. Angenehm zurückhaltend und bescheiden kommt diese Art von Nationalstolz in der Regel daher. Und der eher dezente Text der Hymne passt dazu ziemlich gut.
Nach Kilometer achtunddreißig - langsam gelangt man in die Nähe der Innenstadt - bekommt das Umfeld ein deutlich industrielleres Gesicht. Hafensilos und Lagerhallen bestimmen kurzzeitig das Bild. Hinter einer Brücke, die man unterquert, ändert es sich aber erneut. Denn anstelle des Fjordes erstreckt sich jetzt rechter Hand ein großer Jachthafen.
Auf dem Hügel hinter dieser natürlichen Bucht stehen Häuser, die klar machen, dass bei diesem Stadtbezirk - wie der Hügel selbst "Storhaug", also "großer Hügel" genannt - wohl nicht unbedingt um einen sozialen Brennpunkt handeln dürfte. Die Gegend um den Hafen, in dem es von Booten nur so wimmelt, trägt sogar den schönen Namen "Paradis".
Doch irgendwie gar nicht paradiesisch fühlt sich die Straße "Paradisveien" an, auf der wie üblich mit einem Warndreieck der einundvierzigste Kilometer angezeigt ist. Denn um zu dieser Marke zu gelangen müssen noch einmal ungefähr zwanzig Höhenmeter auf dem spürbar ansteigenden Asphalt überwunden werden.
 |
 |
| Eine letzte kleine Kuppe bringt die Läufer innerhalb weniger Meter vom See zum Meer | |
Genau diese Meter verliert man allerdings wenig später schon wieder. Denn gleich nachdem der Paradisvei an einer Hauptverkehrsstraße geendet hat, zweigt dort wieder jene Kongsgata ab, die Hel- und Halv-Marathonis zum Endspurt ins Stadtzentrum bringt. Den touristischen Höhepunkt der Streckenführung hat man sich bis zum Schluss aufgehoben. Am Ende des Gefälles wartet mit dem Breiavatn als letzter zu umlaufender See nämlich genau jener Teich, der an die Domkirke angrenzt.
Es herrscht Betrieb auf den Spazierwegen rund um die kleine Wasserfläche mit der großen Fontäne in der Mitte. Doch nicht etwa aufgrund der Läufer. Am Samstagmittag bei inzwischen sogar manchmal durch die Wolken brechendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um zwanzig Grad bietet er sich als Flanierbereich oder auch als kurze Unterbrechung des Einkaufbummels geradezu an.
Die nun in dichter Folge aufgestellten Soldaten haben jedenfalls manchmal ihre liebe Mühe, den nicht mehr unbedingt immer in großen Pulks ankommenden Läufern ihren doch eher schmalen Weg wirklich frei zu halten. Aber trotzdem kommt es eigentlich nicht zu echten Behinderungen. Auch wenn sich viele der Vorbeikommenden nicht unbedingt für den Marathon interessieren, ist Rücksichtnahme fast selbstverständlich.
Eine letzte kleine Kuppe neben der mittelalterlichen Kathedrale bringt die Läufer auf die ziemlich kurze Zielgerade über den Torg hinunter zum Våg. Es ist nicht unbedingt ein triumphaler Einlauf. Weder Zuschauermassen noch großes Zieltor erwarten die Marathonis. Keine Boxen wummern und kein Sprecher versucht das Publikum mit andauernden Sprüchen zu Jubelstürmen hin zu reißen. Selbst die Zeitmessmatte wird hinter einer leichten Kurve erst im letzten Moment sichtbar. Doch die Atmosphäre ist dafür freundlich entspannt und keineswegs aufgeregt hektisch.
Als Allererster löst aufgrund des Zeitplanes Ørjan Grønnevig vom ausrichtenden GTI die Zeitnahme im Ziel aus. Nur 30:28 benötigt er für die zehn Kilometer entlang des Hafens. Sein engster, eine 30:40 laufender Verfolger trägt den "typisch norwegischen" Namen Frew Zenebe Brkineh und startet für den Nachbarverein Sandnes Ildrettslag. Hinter den beiden Lokalmatadoren klafft dann allerdings schon eine deutliche Lücke. Gjermund Groven als Dritter wird nämlich erst mit 34:14 in die Liste eingetragen.
 |
 |
 |
| Direkt am Vågen-Hafen und deshalb mitten im Zentrum von Stavanger befindet sich das Ziel | ||
Obwohl fast exakt die Hälfte des Feldes aus Frauen besteht, fallen deren Leistungen dagegen ziemlich deutlich ab. Der Siegerin Ann Christine Dirland genügen gerade einmal 45:35 für die oberste Treppchenstufe. Kjersti Tungland in 49:15 auf Rang zwei und Julie Rage, die mit 49:31 Gesamtplatz drei erläuft, sind noch deutlich weiter zurück.
Das sieht beim Halbmarathon schon deutlich besser aus, denn Elise Hay Opsahl,
die ebenfalls GTI Stavanger antritt, läuft mit 1:27:39 auf ein deutlich
höheres Durchschnittstempo als die Siegerin auf der nicht einmal halb so
langen Distanz. Auch Mari Nustad Mauland ist in 1:32:37 noch schneller. Und
Marit Johanne Skorve, die nicht nur Dritte im Gesamteinlauf sondern auch Siegerin
der Klasse K50-54 - "Kvinner" bedeutet "Frauen" - wird,
legt noch eine 1:38:55 hin.
Bei den Herren scheint das Ergebnis an der Spitze fast ein Spiegelbild des
Zehners zu sein. Denn wieder lautet das Duell GTI Stavanger gegen Sandnes Idrettslag.
Und wieder kommt der Sieger mit Ragnar Stølsmark in 1:11:34 am Ende vom
Ausrichter. Jonathan Charles Duncan vom Nachbarklub folgt in 1:12:52. Gut zwei
Minuten dahinter wird Tom Ole Dalsrud mit 1:15:11 registriert.
Und auch beim zahlenmäßig nicht gerade stark besetzten Marathon sind die Leistungen durchaus beachtlich. Stephan Isom läuft mit 2:44:58 sogar klar unter einem Schnitt von vier Minuten auf den Kilometer, Martin Mølsæter trifft ihn mit 2:48:39 ziemlich genau. Auch Johannes Erixon aus Schweden (2:56:29) und Olle Paulsson (2:57:27) bleiben unter drei Stunden.
Unter den nur vierzehn Frauen auf der Marathonstrecke ist Hilde Plassen vom Haugesunder Polizeisportverein in 3:14:32 die Schnellste. Die Schwedin Linda Karlsson Kjäll kommt in 3:21:11 auf Rang zwei. Zehn Minuten dahinter ist mit Maris Talv-Laugen in 3:31:08 das Siegerpodest vollständig gefüllt.
Ganz egal, welchen Wettbewerb man sich ansieht, es ist auffällig, dass überall die - allerdings bis neununddreißig Jahre gehende - Hauptklasse mit Abstand am besten besetzt ist. Sowohl qualitativ wie quantitativ. Das hierzulande nicht seltene Bild, dass die Altersklassen jenseits der vierzig sowohl im Feld wie auch auf dem Siegertreppchen dominieren, lässt sich in Stavanger nicht beobachten.
Bis auf Marathonsiegerin Hilde Plassen stammen alle anderen Gesamtsieger aus der Hauptklasse. Und auf der langen Distanz ist Plassen allerdings die einzige Läuferin in der K40-45. Aus der K20-K39 kommen dagegen elf der vierzehn Frauen, eine weitere Teilnehmerin ist sogar noch jünger. Überaltert ist das Feld beim Stavanger Marathon also nicht unbedingt.
Doch noch ist man vom Ziel, eine echte Großveranstaltung zu sein, ein ganzes Stück entfernt. Im Ziel werden schließlich 120 Läufer beim Marathon, 435 Halbmarathon und 166 über zehn Kilometer registriert. Zusammen mit den 153 Kindern verpasst man damit die erhoffte Vierstelligkeit am Ende doch klar.
 |
 |
| Noch ist der Zielbereich der Größe der Veranstaltung angemessen eher unspektakulär, doch geht es nach den Wünschen der Organisatoren, wird das spätestens in ein paar Jahren ganz anders aussehen | |
Grämen sollten sich die Macher allerdings nicht, schließlich können sie erneut eine Steigerung registrieren. Und ein zu großer Zuwachs kann sich schon im nächsten Jahr, wenn die Messlatte dann auf einmal deutlich höher hängt, als ziemlicher Fluch heraus stellen. Und gerade im deutschsprachigen Raum sind inzwischen bei vielen Marathons die Folgen eines zu schnellen Wachstums ohne die entsprechende solide Teilnehmerbasis sichtbar.
Selbst wenn es in der lange eher schwach aufgestellten norwegischen Laufszene zur Zeit spürbar bergauf geht und das Interesse an der Teilnahme an Laufveranstaltungen steigt, werden die Macher von GTI Stavanger die von ihnen erhofften mehrere Tausend Starter bei realistischer Betrachtung wohl nicht innerhalb der veranschlagten wenigen Jahren erreichen können. Doch dauerhaft etablieren sollte sich dieser Marathon auf jeden Fall.
Und mit einem verstärkten Bemühen um ausländische Lauftouristen könnte man vielleicht tatsächlich einen gewissen Erfolg haben. Stavanger ist schließlich aufgrund eines auch aus dem Ausland angeflogenen Flughafens relativ gut zu erreichen. Vor allem aber bietet sich die Stadt als ziemlich guter Startpunkt für eine Reise in eine spektakuläre und einzigartige Landschaft an, das norwegische Fjordland. Denn Stavanger liegt am Anfang der Fjorde.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos stavangermarathon.no Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.