

 |
 |
 |
 |
 |
 |
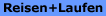 |
 |
 |
 |
 
|
30.3.08 - Monaco MarathonMonaco ist ... manchmal auch Marathon |
|
von Ralf Klink
|
Was ist Monaco überhaupt? Ein richtiger Staat? Oder doch nur eine Stadt? Lohnt es, sich mit Monaco weiter zu beschäftigen? Lohnt es sich, ein paar Gedanken an Monaco zu verschwenden? Nun, woran denkt man denn zuerst, wenn man diesen Namen hört? An das Kasino von Monte Carlo, das zwar nicht die älteste, auch nicht die größte, aber höchstwahrscheinlich die bekannteste Spielbank weltweit ist? An zwei Autorennen, die Rallye Monte Carlo und den Großen Preis von Monaco, bei denen die PS-strotzenden Boliden, einmal über verschneite Bergstraßen und einmal mitten durch die Straßenschluchten Monacos rasen?
An die nicht vorhandene Einkommensteuer, die dafür sorgt, dass Großverdiener und Prominente aus unzähligen Ländern ihren offiziellen Wohnsitz im kleinen Fürstentum haben, selbst wenn sie dort eigentlich nicht allzu oft anzutreffen sind?
An einen Regenten, der sich bisher hauptsächlich durch sportliche Aktivitäten hervor getan hat und trotz schon etwas gesetzteren Alters noch immer zu haben ist? An Prinzessinnen, die im krassen Gegensatz dazu mit einem enormen Männerverschleiß aufwarten können?
Nun gerade die zuletzt aufgezählten Punkte dürften das Bild des Kleinstaates in der Öffentlichkeit ziemlich mitprägen. Die Zusammenballung von Geld- und Erbadel, Alt- und Neureichen macht Monaco zu einem geradezu idealen Berichterstattungsobjekt für Regenbogenpresse und Klatschreporter. So vergeht praktisch keine einzige Woche, in der man nicht mindestens eine Meldung darüber lesen könnte. Und untrennbar verbunden damit, ist der Name der Herrscherfamilie. Monaco das bedeutet Grimaldi. Und Grimaldi steht eindeutig für Monaco. Beides ist eine unauflösliche Einheit. Seit Generationen beschäftigen ihre Eskapaden die Menschen. Neben den britischen Royals taucht wohl keine Dynastie so oft in den Schlagzeilen auf. Eine bessere Werbung für das Fürstentum kann es kaum geben.
 |
 |
 |
Die Aufmerksamkeit, die dem Ländchen dabei zuteil wird, passt allerdings irgendwie nicht so richtig zu seiner tatsächlichen Größe. Denn obwohl so ziemlich jedem Leser solcher "Nachrichten" sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier wirklich nur um einen Zwergstaat handelt, dürfte den wenigsten die fast schon unglaubliche Winzigkeit dieses Fleckchens Erde klar sein. Gerade einmal knappe zwei Quadratkilometer umfasst die Landesfläche. In kaum mehr als einer guten halben Stunde kann man diesen "Staat" zu Fuß von einem Ende zum anderen locker durchqueren. Im Schlender- und nicht im Laufschritt. Und zwar der Länge nach. In der Breite reichen an einigen Stellen nur wenige Minuten. Einzig der Vatikan ist noch kleiner.
Selbst die beiden folgenden Einträge in der Rangliste der kleinsten Länder der Erde, die pazifischen Inseln Nauru und Tuvalu übertreffen diesen Wert bereits um das zehnfache. Für San Marino, die von Italien umgebene Minirepublik als nächsten europäischen Kandidaten, wird schon Faktor dreißig fällig. Und alle weiteren unabhängigen Staaten der Erde, selbst wenn sie im internationalen Vergleich immer noch als Winzlinge gelten müssen, warten mit deutlich dreistelligen Quadratkilometer-Werten auf, sind also flächenmäßig rund hundertmal größer als das Fürstentum.
Auch im Hinblick auf die Bevölkerungszahlen ergibt sich nur ein bedingt anderes Bild. Immerhin gelingt es Monaco mit über dreißigtausend Einwohnern hier, neben dem Vatikan noch Tuvalu, Nauru sowie das genauso in der Südsee liegende Palau hinter sich zu lassen und in etwa gleichauf mit San Marino und Liechtenstein zu liegen. Da von dieser Zahl allerdings nur ein gutes Fünftel wirklich monegassische Staatsbürger sind, könnte man diese Rangliste ebenfalls ein wenig anders interpretieren. Jedoch steht man als UN-Vollmitglied juristisch auf einer Stufe mit dem achtmillionenmal ausgedehnteren Russland. Und Verträge mit dem Knapp-Eineinhalb-Milliarden-Reich China würden zumindest formal unter zwei absolut gleichberechtigten Partnern geschlossen. Von einem reinen Operettenstaat zu sprechen, wäre also nicht mehr als nur eine bösartige Verleumdung.
Na ja, vielleicht doch nicht ganz. Aber zumindest etwas Unbedarfteren, ein wenig Naiven kann man so sehr wohl vormachen, es handele sich hier tatsächlich um etwas Ernstes und nicht nur um eine - zugegebenermaßen recht gelungene - Theateraufführung. Monaco ist auf der einen Seite klein und schwach, wirkt fast zart und zerbrechlich. Und hat es auf der anderen doch faustdick hinter den Ohren.
Aufzufallen schadet jedenfalls überhaupt nicht. Schließlich ist die Konkurrenz an der Côte d'Azur nicht gerade klein. Denn neben der keine zwanzig Kilometer entfernten Großstadt Nizza, die mit der berühmten Promenade des Anglais allerdings durchaus Urlaubsflair besitzt, gibt es da zum Beispiel auch noch Saint-Tropez, Cannes oder Antibes. Und jenseits der nicht gerade weiten Grenze zu Italien warten mit klangvollen Namen wie San Remo weitere Orte auf die Touristen und - vermutlich mindestens genauso wichtig - auf zahlungskräftige Neuanwohner.
Wohl nur noch das Nordufer des Genfer Sees mit Lausanne, Vevey und Montreux hat auf Prominente und Wohlhabende eine ähnliche Anziehungskraft. Und auch wenn die Landschaften nicht wirklich gleich sind, so manches erinnert an der Côte durchaus an das schweizerische Lavaux sowie das angrenzende Rhonetal. Die eine oder andere Gemeinsamkeit lässt sich eben durchaus entdecken. Da wären die von Norden praktisch direkt ins Wasser hinein fallenden, steilen Berge, die dadurch Schutz vor arktischen Luftmassen bieten und für ein extrem mildes Klima sorgen. Oder die sich deshalb inzwischen fast übergangslos am Ufer entlangziehende Bebauung. Noch immer vorhandene, eng bebaute alte Ortskerne der ursprünglich kleinen Dörfer, deren Grenzen aber längst durch dazwischen liegende großflächige Anwesen und Feriendomizile völlig verschwimmen. Immer weiter den Hang hinauf wandernde Villengürtel, stets auf der Suche nach einer neuen, bisher noch freien Sonnenterasse.
Und doch sticht Monaco aus all der namhaften lokalen Konkurrenz aufgrund unverwechselbarer Eigenschaften unübersehbar heraus. Monaco ist etwas ganz Besonderes. Monaco kann eine enorme Faszination ausüben. Monaco ist fast schon etwas Einzigartiges. In vieler Hinsicht, nicht nur positiver, auch in negativer. Und nicht immer sind beide klar zu unterscheiden. Zwei besondere Eigenschaften sind wieder mit Statistiken leicht aufzuzeigen. Zwei Statistiken, in denen der Zwergstaat diesmal mit großem Vorsprung führt.
 |
 |
 |
Die eine ist mit "Bevölkerungsdichte" überschrieben. Mit einem Wert jenseits der sechszehntausend Einwohnern pro Quadratkilometer liegt man hier bei deutlich über dem Doppelten des ärgsten "Verfolgers" Singapur. Und der Nummer drei - dem Vatikan - kann man schon nur noch ein gutes Zehntel dieser Menschenzusammenballung nachweisen. So ist dann auch so ziemlich jeder Meter Fläche der "Principauté de Monaco" irgendwie genutzt. Grünflächen, Parks, Ruhezonen sind die absolute Ausnahme. Und Brachland gibt es überhaupt nicht. Dazu war und ist Grund und Boden viel zu kostbar. Wo auch nur etwas Platz entstehen könnte, wird er sofort für neue Projekte verplant. Ideen gehen den Monegassen und insbesondere der regierenden Dynastie Grimaldi nicht aus.
Ruhe kann Monaco so nicht finden. Gebaut wird ständig irgendwo. An irgendeiner Stelle steht immer ein Kran. Und nichts an Monaco ist dabei wirklich beständig. In kürzester Zeit kann sich alles verändern. Was gestern noch eine traumhafte, wunderschöne Aussicht war, kann heute schon eine triste, kalte, abweisende Wand sein. Es ist schon erstaunlich, was man da in der Vergangenheit bereits alles untergebracht hat. Nicht nur Wohnungen in immer weiter in den Himmel wachsenden Hochhäusern. Auch Büroräume oder zumindest Briefkästen für unzählige Firmen, hauptsächlich Banken. Kongress- und Einkaufszentren. Kulturelle Einrichtungen wie Museen und Theater. Sogar den einen oder anderen Industriebetrieb. Und vor allem eben auch einige riesige Hotels. Doch Monaco bietet fast schon selbstverständlich nahezu ausschließlich Übernachtungsmöglichkeiten, die hinterher mit einem enorm hohen Preis bezahlt werden müssen. Auch nur ein paar schöne Tage Monaco sind meist unheimlich teuer erkauft.
Womit man bei der zweiten Rangliste angelangt wäre, in der das Fürstentum weltweit die Nummer eins ist. Sie heißt "Millionärsdichte". Nirgendwo auf dem Globus besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Nachbar siebenstellige Beträge auf seinen Konten liegen hat. Was angesichts der Wohnumstände, die manchmal fast an die Käfighaltung von Hühnern erinnert, eigentlich kaum zu erklären ist. Doch die absolute Steuerfreiheit sorgt dafür, dass sich Großverdiener lieber hier ein kleines Appartement kaufen als in der Nachbarschaft eine große Villa. Zumindest auf dem Papier haben sie dann ihren Hauptwohnsitz im Fürstentum und deshalb auch keinen Kontakt mehr mit dem Finanzamt ihres Herkunftslandes.
Dafür dass nicht jeder auf den Gedanken kommt, sich so um die lästige Steuererklärung zu drücken, sorgen dann schon die Preise. In nur wenigen Städten der Welt dürfte es ähnlich teuer sein wie in Monaco. Die Anforderungen, die man erfüllen muss, um auch nur ein kleines Plätzchen, ein Eckchen irgendwo im Herzen der Principauté zu bekommen, sind jedenfalls immens. Denn obwohl diese "Résidents" - bis auf die Franzosen, denn der große Nachbar hat dem kleinen Monaco die Besteuerung seiner Bürger abgetrotzt - keine Steuern zahlen, bringen sie natürlich trotzdem Geld ins Land. Behindert wird der Zuzug deshalb weder vom Herrscherhaus noch von der Regierung des Stadtstaates. Unter der mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Führung des bisher vorletzten Grimaldi-Regenten Rainier III hat sich die Einwohnerzahl jedenfalls nahezu verdoppelt.
Und je mehr so ein Neubürger im Portemonnaie hat, umso besser für das Fürstentum. Gewinner sind gefragt. An Verlierern hat man weniger Interesse. Der Versuch, sein Glück in oder mit Monaco zu machen, ist in der Regel völlig vergebene Liebesmühe. Man kann es zwar hier suchen, es ist allerdings doch ziemlich unwahrscheinlich, es auch zu finden. Man sollte es lieber besser gleich mitbringen. Auch das für Monaco einst unersetzliche und auch heute noch immer wichtige Spielkasino hilft da wenig. Zumal das Wortspiel mit dem "Glück", das man angeblich beim Spiel haben und finden kann, sowieso nur auf Deutsch richtig funktioniert. Die Mehrdeutigkeit von "Glück" bringen im hier als Amtssprache genutzten Französisch - das ursprüngliche Monegassisch, ein provençalisch-ligurischer Mischdialekt, stand eine Zeit lang sogar kurz vor dem Aussterben, wird jetzt aber zumindest wieder etwas gepflegt - je nach Situation ganz unterschiedliche Worte wie "hasard", "chance" oder "bonheur" zum Ausdruck. Und auch im Englischen ist ja zwischen "lucky" und "happy" ein himmelweiter Unterschied.
Wobei die Frage erlaubt sein muss, ob ein Spielgewinn denn überhaupt wirklich glücklich machen kann. Das Wörtchen "Zufall" scheint jedenfalls für das, was da an den Roulettetischen passiert, deutlich angebrachter. Denn rein mathematisch, rein statistisch verliert auf Dauer ohnehin jeder. Manche früher, von Anfang an. Manche eigentlich nur. Manche eben etwas später, nachdem sie eine Zeit lang glaubten, doch eine Glückssträhne gefunden zu haben. Aber das Risiko ist stets größer als die Chance. Am Ende bleibt selten etwas übrig. Bonheur fragile - zerbrechliches Glück. Um hohe Einsätze spielt man vielleicht doch besser nur, wenn man selbst die Regeln bestimmen kann. Denn einzig und allein die Bank gewinnt immer.
 |
 |
 |
Und genau davon konnte Monaco lange ganz gut leben. Als man vor ziemlich genau eineinhalb Jahrhunderten im Zwergstaat auf der Suche nach neuen Einnahmequellen war, kam man aufgrund des in Frankreich zu dieser Zeit noch absolut verbotenen Glücksspiels auf jenen glorreichen Gedanken, in Monte Carlo ein Kasino zu eröffnen. Nachdem mit dem Anschluss an die Eisenbahn auch die Verkehranbindung gesichert war, fing der Betrieb an zu florieren. Immer neue zahlungskräftige Gäste aus nah und fern strömten nach "Munegu" - wie der Stadtstaat im einheimischen Dialekt geschrieben wird - und wurden hier an den Spieltischen ihr Geld los.
Die cleveren Grimaldi hatten eine - nein, richtiger sie hatten DIE - Goldgrube für ihr Minireich gefunden. Lange deckte man mit den Erträgen aus der Spielbank nahezu den gesamten Staatshaushalt. Und noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als Rainier III seine Dauerregentschaft begann, war es über die Hälfte. Zwar hat sich das inzwischen deutlich verschoben. Der Anteil liegt nur noch bei rund fünf Prozent. Tourismus gilt inzwischen als die wichtigste Einnahmequelle. Doch ohne das Spielkasino und den damit begründeten Ruf würden diese Besuche wohl deutlich weniger zahlreich ausfallen. Die Maschinerie läuft längst absolut reibungslos. Die Wirtschaft brummt. So sehr, dass jeden Tag noch einmal zigtausend Arbeitnehmer aus dem Umland ins Fürstentum hinein pendeln, um hier ihr Geld zu verdienen.
Auch Sportfunktionäre fühlen sich - nach eigenen Aussagen natürlich absolut nicht nur aus pekuniären Gründen - in solcher Umgebung durchaus wohl. Zwar hat man in der Schweiz und insbesondere im oben schon erwähnten Waadtland dabei die Nase noch deutlich vorne. Denn in Lausanne hat sich das IOC seinen Sitz gesucht. Und etliche Fachorganisationen wie Tischtennis, Volleyball, Hockey, Fechten, Reitsport, Schwimmen, Kanu und Rudern sind direkt daneben ans Ufer des Lac Leman gezogen. Doch in Monaco kann man immerhin mit dem Leichtathletikweltverband IAAF und dem Verband für Modernen Fünfkampf aufwarten. Der Bund der internationalen Sportverbände hat sich ebenfalls im Fürstentum niedergelassen. So bleibt der Ministaat zumindest sportpolitisch ständig auf der Landkarte.
Zu einem richtigen Staat gehören dann selbstverständlich auch die entsprechenden sportlichen Großveranstaltungen, mit denen man sich ganz nebenbei auch weiter im Gespräch halten kann. Ob man die beiden Autorennen wirklich dazu zählen und die Raserei als Sport ansehen will, hängt ganz vom Blickwinkel des Betrachters ab. Wichtige Publicity für Monaco bringen sie auf jeden Fall. Beim hochklassig besetzten Tennisturnier, das einen Großteil der Herren-Weltelite an die Côte d'Azur lockt, ist der Diskussionsbedarf sicher deutlich kleiner.
Und der Start der Tour de France im Jahr 2009 dürfte unzählige Fernsehteams in den Ministaat führen. Auch das Leichtathletikmeeting bringt die "Principauté de Monaco" jedes Jahr weltweit auf die Bildschirme. Im immerhin über die Hälfte der Bevölkerung fassenden Stadion wurde sogar dreimal das Finale der Grand-Prix-Serie veranstaltet, bevor es in den letzten Jahren nach Stuttgart wanderte.
Fußball spielt man in diesem Stadion ebenfalls. Und zwar auf allerhöchstem Niveau. Mangels Konkurrenz im eigenen Land kickt der AS Monaco nämlich in Frankreich in der ersten Liga mit. Dass man dabei auch schon siebenmal die französische Meisterschaft gewinnen konnte, zeigt das seltsame Verhältnis zum großen Nachbarn zwischen Ab- und Unabhängigkeit, zwischen Heranziehen und Wegschieben auch im sportlichen Bereich recht deutlich. Nicht einmal einen eigenen Fußballverband oder eine Nationalmannschaft - zumindest keine offiziell anerkannte - besitzt man. Echte Länderspiele finden deshalb auch keine statt. Nur gegen die Auswahlen von Nicht-, Noch-Nicht- oder Nicht-Ganz-Staaten tritt man gelegentlich an. Ohne die - sowieso hauptsächlich französischen - Profis. Und mit eher mäßigem Erfolg. Die paar Fußballer unter den sowieso nicht gerade vielen monegassischen Staatsbürgern mussten sich zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit mit einer deftigen 21:1 Packung gegen Lappland abfinden. Aber dem Vatikan konnte man immerhin auch schon einmal ein 0:0 abringen.
 |
 |
 |
Da sind die monegassischen Leichtathleten schon deutlich weiter. Schließlich ist ihr Verband bei der IAAF Vollmitglied. Was angesichts der räumlichen Nähe zur Dachorganisation allerdings dann auch nicht ganz so verwunderlich ist. Und Vorsitzender ist der regierende Fürst Albert II sogar höchstpersönlich. Zumindest auf dem Papier. Die Arbeit machen wohl doch eher andere.
Aber auf welchem Niveau hier Leistungen erbracht werden, zeigen die - zudem auch schon etwas angestaubten - nationalen Rekorde im Marathon recht deutlich. Bisher knackte nämlich nur Pierre Maccario in 2:59:26 hauchdünn die drei Stunden. Und bei ähnlich schwachen 3:35:39 steht Adrienne Pastorellys Frauenbestleistung. Die Zahl der Clubs mit höherwertigen Vereinsrekorden hierzulande dürfte die Zahl der Mitglieder des monegassischen Verbandes klar übersteigen. Wer aber unter den ambitionierten Läufern jetzt meint, da sei die Gelegenheit, sich schnell mal einen Landesrekord zu sichern, dem sei gesagt, dass die Staatsbürgerschaft von Monaco nur bei "besonderen Verdiensten" um den Stadtstaat vom Fürsten persönlich verliehen wird. Was diese "Verdienste" in Euro bedeuten könnten, darüber redet man dann allerdings doch lieber nicht.
Von Klarheit, Deutlichkeit und Offenheit keine Spur. Das hat man ja auch gar nicht nötig. Echten Einfluss auf den Ausgang der Geschichte besitzt der begutachtete Kandidat jedenfalls nicht. Antrag hin, Antrag her. Die Entscheidung hängt ganz alleine an Lust und Laune, an der Willkür der Grimaldi. Und so mancher hat auch schon bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf eine eindeutige Beantwortung seiner Anfrage gewartet. Dann hat der Bewerber halt Pech gehabt. In einem Land, in dem der Zufall eine so wichtige Rolle hat, muss man sich eben auf so etwas einstellen. Jedenfalls ist es angesichts der Verhältnisse kein wirkliches Wunder, dass gerade einmal zwei echte Monegassen in der Ergebnisliste "ihres" Marathons zu finden sind. Denn selbstverständlich gehört zu einem richtigen Staat auch ein eigener Lauf über die weltweit bekannten 42,195 Kilometer. Und den besitzt man seit einem Jahrzehnt auch im Fürstentum. Mit gut tausend Teilnehmern nicht unbedingt ein Riese, aber durchaus auch kein Zwerg.
Natürlich ist der Marathon von Monaco trotz des nicht einmal im Promillebereich liegenden Anteils einheimischer Starter keine rein für Lauftouristen ausgerichtete Veranstaltung wie Rennen auf der Chinesischen Mauer oder vor irgendwelchen ägyptischen Tempeln. Zum einen ist die Relation der beiden monegassischen Marathonis zur Gesamtbevölkerung nämlich gar nicht einmal so übermäßig schlecht, wenn auch etwas unter dem deutschen Schnitt, der ja angeblich bei einem guten Promille liegt. Zum anderen sorgen selbstverständlich auch etliche Franzosen aus der Umgebung für entsprechende lokale Beteiligung. Zumal es ja sowieso eher ein französischer Marathon ist. Denn selbst wenn man in Monaco eine eigene Leichtathletikföderation besitzt, in den Wettkampfregeln hält man sich an das große Nachbarland. Was für alle Teilnehmer entweder die Vorlage einer "Lizenz" - dazu zählt auch ein DLV-Startpass - oder aber eines ärztlichen Attests bedeutet.
Und auch der größere Teil des Kurses wird außerhalb des Fürstentums absolviert. Was anderen Kleinstaaten wie Malta oder Liechtenstein mit ein paar Schleifen noch mühelos gelingen kann, nämlich 42 Kilometer auf dem eigenen Territorium zusammen zu bekommen, ist für Monaco ein Ding der Unmöglichkeit. Folgerichtig heißt die Veranstaltung dann auch mit vollem Namen "Marathon de Monaco und des Riviera". Den elften hat man inzwischen davon ausgeschrieben. Doch mit der Zählerei ist das so eine Sache. Denn wie soll man den im Jahr 2000 ausgefallenen Lauf werten? Aufgrund von Unwetterschäden mussten sich damals alle gemeldeten Marathonis mit einem Zehner begnügen. Man rechnet ihn trotzdem mit.
Dass man im Zwergstaat nun vom angestammten November-Termin ins Frühjahr gewechselt ist, macht die Verwirrung nur noch größer. Das freigewordene Herbstwochenende hat zudem flugs ein neuer Côte-Marathon in Beschlag genommen. Denn am 9.11.2008 besteht nun auch die Möglichkeit, die klassische Distanz von Nizza nach Cannes zu laufen. Ob man hier in Zukunft vernünftig miteinander auskommt oder einer von beiden am Ende auf der Strecke bleibt, wird sich zeigen.
 |
 |
 |
Während man sich beim Neueinsteiger den zusätzlichen organisatorischen Aufwand einer Punkt-zu-Punkt-Strecke zumutet, setzt man in Monaco nach wie vor auf einen Wendepunktkurs. Die in Anzeigen und auf Plakaten groß angekündigte Streckenänderung ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Start und Ziel liegen zwar ein Stück auseinander, doch in - bei der Größe von Monaco eigentlich auch kein Wunder - einer in wenigen Minuten zu Fuß zurück zu legenden Distanz. Das Einlauf- und auch das Wettkampfzentrum befinden sich im Stadion ganz am südwestlichen Ende des Stadtstaates. Da die Strecke von Monaco aus nach Osten führt, wird das Ländchen so zumindest einmal in seiner vollen Länge durchlaufen. Und die dort vorhandene Logistik mit Duschen, Parkhausstellplätzen etc. ist für die Teilnehmerzahl voll und ganz ausreichend.
Schon ab Freitag werden hier die Startnummern verteilt - aus den Kassenschaltern am Stadioneingang. Ein Funktions-T-Shirt des Bekleidungssponsors gibt es noch dazu. Bei Startgebühren zwischen 30 (bis Ende November) und 50 (bei Nachmeldung) Euro ein durchaus akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie es sich für einen Staat gehört, der sich zumindest teilweise über das Spiel definiert, dient die Startnummer auch gleich wieder als Los. Nicht für eine langatmige Tombola, mit der anderswo die Zeit bis zur Siegerehrung mehr schlecht als recht überbrückt wird. Nein, Monaco lässt sich und anderen nicht so viel Zeit. Monaco hat dafür überhaupt keine Geduld. Monaco sucht die schnelle Entscheidung. Monaco hat es stets ziemlich eilig.
Die gewinnenden Zahlen sind bereits an einem Stand auf der kleinen Marathonmesse ausgehängt. Alle Preise können dort sofort abgeholt werden. Gegen Vorlage der Nummer darf man in eine Kiste greifen und sich irgendeinen Zettel herausholen, auf dem die unterschiedlichen Gewinne stehen. Durchaus interessante Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Laufrucksäcke werden dabei unter die Leute gebracht. Glück? Na ja, wohl doch wieder einfach nur Zufall.
Auch ein Zettel liegt bei den Unterlagen: "Attention !! Dimanche changement de l'heure" - "Achtung !! Sonntag Zeitumstellung". Schon mit der Meldebestätigung hat man einen ähnlichen Hinweis erhalten. Schließlich wird die Uhr an diesem Wochenende nach vorne gestellt. Die Nacht ist wieder einmal eine Stunde kürzer. Und wer da nicht daran denkt, rechtzeitig aktiv zu werden, kommt eben zu spät und kann dann nur noch enttäuscht hinterher blicken.
So wird dann auch die für einen Marathon im Süden recht späte Startzeit von 9:30 wieder ein wenig relativiert. Noch einen Tag zuvor wäre das nämlich 8:30 gewesen. Aber warm ist es dennoch. Bis zur Mittagszeit wird das Quecksilber an der Zwanzig-Grad-Marke kratzen. Und keine Wolke trübt den azurblauen Himmel, als sich die Läuferschar langsam vom Stadion hinüber zum Hafen in Bewegung setzt. Die Sonnenbrille kann nicht nur nicht schaden, für empfindlichere Augen ist sie sogar unbedingt nötig.
Dort wo Ende Mai wieder die Motoren der Formel 1 dröhnen werden, bis die Ampel auf grün springt, ist auch der Startbogen des Marathons aufgebaut. Wie sehr diese Veranstaltung, bei der Unsummen für jeden noch so kleinen Platz an der Rennstrecke gezahlt werden, die Stadt in Atem hält, zeigt die Tatsache, dass man bereits zwei Monate vorher mit dem Aufbau riesiger Stahltribünen entlang des Hafenbeckens begonnen hat. Auch erste Leitplanken sind schon wieder angeschraubt. Die Frage, warum man das angesichts solcher Montagezeiten überhaupt abbaut, scheint beinahe berechtigt.
Nur einen Steinwurf entfernt im Stadtteil La Condamine findet man auch den Sitz der IAAF. Doch von den ganz hohen Herren des Weltverbandes dürfte niemand den Marathon vor der eigenen Haustür verfolgen. Schließlich finden am selben Tag im Edinburgher Holyrood Park die Cross-Weltmeisterschaften statt, bei denen sich Kenenisa Bekele mit seinem sechsten Langstreckentitel endgültig den Platz in den Sportgeschichtsbüchern sichert. Ende Mai - zufälligerweise am gleichen Tag wie das Autorennen in Monaco - wird übrigens an gleicher Stelle auch der Marathon der schottischen Hauptstadt gestartet.
Doch ein anderer hoher Herr ist sehr wohl anwesend. Fürst Albert persönlich gibt sich die Ehre, dem Start beizuwohnen. Und das ist vielleicht sogar auch in sportpolitischer Hinsicht fast noch wertvoller. Der Prince - hier ist ausnahmsweise mal die deutsche Sprache mit ihrer Unterscheidung zwischen Prinz und Fürst, Prinzessin und Fürstin genauer als das Französische und das Englische, die für beide Titel jeweils die gleichen Worte nutzen - ist schließlich auch IOC-Mitglied.
Pünktlich 9:30 Sommerzeit geht es ohne große Worte des Schirmherren einfach los. Das Spiel ist eröffnet. Noch hat jeder persönliche Ziele, Hoffnungen, Träume. Nicht alle werden sich erfüllen. Manches wird auch in einer großen Enttäuschung enden. "Mesdames et Messieurs, faites votre jeu". Zwar heißt der Startplatz "Boulevard Albert", doch der Zusatz "1er" zeigt, dass er nicht schon nach dem regierenden Fürsten sondern nach seinem Ururgroßvater benannt ist. Und der war, wie man fast sagen könnte, ein richtig typischer Grimaldi. Einer, der wie etliche andere seiner Familie mit einer wechselvollen, wilden persönlichen Geschichte und vielen unterschiedlichen, zum Teil völlig widersprüchlichen Charaktereigenschaften nahezu perfekt zum Fürstentum passt. Ein Abenteurer, der ständig in der Welt unterwegs war, der in der spanischen und französischen Marine diente, der viel Zeit bei Forschungsreisen auf See verbrachte, der aber auch auf zwei schnell vollkommen gescheiterte Ehen zurückblickte.
 |
 |
 |
 |
Allerdings ein cleverer Geschäftsmann, der die Geschicke seines kleinen Reiches, bei seinen ausgedehnten Touren über Funk steuerte, der mit den Kasinoerträge das Ozeanografische Museum gründete, das heute noch eine touristische Attraktion von Monaco ist. Einer, der vieles und viele zu seinem und Monacos Vorteil zu nutzen verstand. Ein durchaus typischer Grimaldi. Denn schon die Geschichte, die man sich vom ersten Auftreten jenes Dynastie in Monaco erzählt, wird durch diese "Cleverness" geprägt. Francesco Grimaldi, ein aus Genua vertriebener Adliger, tritt in einer eisigen, stürmischen Januarnacht des Jahres 1297 mit einigen seiner Gefolgsleuten als Franziskaner verkleidet vor die Festung. Angesichts der scheinbaren Harmlosigkeit und der offensichtlichen Notlage jener doch so unverschuldet leidenden Mönche öffnet sich ihnen auch schnell die Pforte.
Aber die angeblichen Ordensbrüder haben die Hilfsbereitschaft, die Gutgläubigkeit und das Vertrauen der unbedarften Besatzung nur für ihre eigenen, egoistischen Zwecke ausgenutzt. Nachdem sie eingetreten sind, zeigen die "armen Bedauernswerten" auf einmal ihr wahres Gesicht. Urplötzlich zücken sie ihre unter den Kutten versteckten Waffen und fangen an damit rücksichtslos auszuteilen. Die total verdutzten Wachen, die doch eigentlich nur Gutes tun wollten, wissen gar nicht richtig, wie ihnen geschieht, sind absolut überrumpelt. Nur wenig später ist die Kampfkraft der Verteidiger deshalb auch vollkommen zerbrochen und die Burg im Handstreich genommen. Francesco Grimaldi hat mit einer schauspielerischen Glanzleistung seine ganz persönlichen Ziele erreicht.
Positiv ausgedrückt könnte man bei dieser Aktion von einer gelungenen Kriegslist sprechen. Es gäbe dafür aber sicher auch andere, weniger schöne Worte. Doch da hier - wie meist - die Geschichtsschreibung diejenige der Gewinner ist, zeigt das Wappen von Monaco stolz zwei schwertschwingende Mönche. Nach der Sicht der so grausam an der Nase herum geführten Verlierer fragt eigentlich niemand mehr.
Oben auf der inzwischen mit Fürstenpalast und Altstadt bebauten Festung, die sich im Rücken der sich langsam zur Startaufstellung versammelnden Läufer hoch über den Hafen erhebt, hat man Francesco bzw. François sogar ein Denkmal gesetzt. Die Marathonis werden jenen Felsen - meist nur "le Rocher" genannt - der die Keimzelle Monacos war und immer noch das Herz der Principauté ist, auf ihrer Runde allerdings nicht erreichen. Dorthin lässt man sie dann doch nicht.
Überhaupt ist der Teil des Kurses, der durch das Fürstentum führt, eigentlich nicht wirklich attraktiv. Oft sieht man sogar überhaupt nichts von Monaco. Denn nicht einmal einen Kilometer nach dem Überschreiten der Startmatte verschwindet der Läuferpulk bereits in einem der vielen Tunnels der Stadt.
Es wird nicht bei dem einen bleiben. Am Ende des Laufes kann man sich durchaus fragen, ob nicht der Name "Marathon de Monaco et des tunnels" gerechtfertigt wäre. Insgesamt dürften wohl bestimmt zwanzig Prozent der Distanz darin zurückgelegt werden. Bei der Principauté ist das auch gar nicht verwunderlich. Trotz des nahezu ständigen Sonnenscheins an der Côte d'Azur findet man in Monaco eben auch viele dunkle Stellen. Denn kaum eine längere Straße, die in ihrem Verlauf nicht mindestens einmal im Berg verschwindet. Jeder Quadratmeter ist ja kostbar. Also versucht man gerade die Verkehrsflächen möglichst unter die Erde zu verlegen.
Die Felsen unter der Stadt sind löchrig wie ein Schweizer Käse. So manche tiefe Wunde hat Monaco auf der Suche nach Freiraum ins wehrlose Gestein geschlagen. Vielleicht auf ewig zementierte Narben einer unentwegten Ruhelosigkeit. Nicht nur Straßen, auch nahezu alle Parkhäuser sind unterirdisch angelegt. Und die Bahnlinie von Nizza nach Genua verläuft durch das komplette Staatsgebiet inzwischen als U-Bahn. Am letzten Stück, auf dem die Gleise oberirdisch lagen, stehen jetzt die Baukräne. Monaco wandelt wieder mal das Gesicht. Schon beim nächsten Besuch kann alles völlig verändert sein.
 |
 |
 |
Auf den Tunnel folgt direkt und völlig übergangslos eine Brücke. Auch Brücken sind nicht unbedingt eine Seltenheit in einer Stadt, die sich - eingezwängt von Berg und See - an den Hang quetscht. Monaco bewegt sich auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Monaco ist ziemlich vielschichtig. Denn jede Straße, die sich ein wenig weiter vom Mittelmeer entfernt, liegt eben auch ein Stück weiter oben. So mancher Hauseingang findet sich auf der Bergseite auch im fünften, sechsten oder siebten Stock. Von der nur wenige Meter entfernten Parallelstraße kann man dagegen ganz normal parterre eintreten.
In der steilen Schlucht, die von den Marathonis da überquert wird, rauscht kein schäumender Wildbach. Auch hier sind - so weit irgendwie möglich - alle Stellen bebaut. Oben schwebt so manches Haus bedenklich dicht an der Abbruchkante. Rechter Hand erkennt man ein wenig unterhalb den Hafen, wo man vor wenigen Minuten losgelaufen ist. Und links türmt sich die riesige Glasfront, durch die man in den unterirdischen Bahnhof gelangt, auf. Der neue Gare de Monaco / Monte Carlo hat aufgrund dieses zumindest ein wenig Tageslicht durchlassenden Eingangs fast etwas Höhlenartiges. Faszinierend, intelligent, aber auch lieblos und kalt. Monaco eben.
Doch nur kurz können die Läufer ihren Blick wandern lassen, dann schauen sie schon wieder in die Röhre. Die Brücke wird sofort vom nächsten Tunnel abgelöst. Es geht in Richtung Kasino. Doch obwohl sich die knapp vier Kilometer lange Einführungsrunde am Kurs der Formel 1 orientiert, kommen die Marathonis im Gegensatz zu dem Rennwagen nicht direkt an der Spielbank vorbei. Die alte Strecke passierte diesen Prachtbau noch. Seit diesem Jahr bleibt nun auch die zweite Hauptsehenswürdigkeit den Läufern vorenthalten. Warum ist nicht so ganz nachvollziehbar. Zwar liegt das Kasino wie der Name "Monte Carlo" schon aussagt auf einem Hügel und man müsste ein paar zusätzliche Meter klettern. Doch angesichts des mit zwei- bis dreihundert zu erklimmenden Höhenmetern sowieso nicht einfachen Profils, wäre es darauf dann auch nicht mehr angekommen. Antworten bekommt man von Monaco keine. Es ist eben so. Monaco hält sich nicht lange mir Erklärungen auf.
Vielleicht passen die verschwitzten, halbnackten Körper selbst um diese frühe Stunde nicht so recht ins Ambiente rund um die Spielbank, wo vor dem Hotel de Paris Autos herum stehen, für deren Kaufpreis man anderswo auch ganze Häuser bekommen könnte. Vielleicht sind Marathonis für Monaco dann einfach nicht wichtig genug, als dass man sich um sie allzu viele Gedanken machen müsste. Man hat sie zwar gelockt, aber alles muss man ihnen dann doch nicht eröffnen. Monaco sucht wohl eher andere Kicks. Dinge, die mehr Adrenalin erzeugen, die mehr hermachen. Simple Marathonläufer sind da eventuell doch nicht das Richtige. Die sind für Monaco nicht interessant, nicht gut genug. Die sind einfach zu bieder, zu langweilig. Monaco braucht halt ständig neue Sensationen. Monaco ist schon ziemlich wählerisch.
Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen, wenn man sich den Zuschauerzuspruch betrachtet. Nun darf man sich bei Marathons im Ausland zwar nicht unbedingt an Verhältnisse wie in Hamburg oder Berlin orientieren. Da fallen selbst internationale Großveranstaltungen im Publikumsinteresse gegen deutsche Mittelklasseläufe drastisch ab. Doch bis auf ein paar Ordner und Helfer - die sind allerdings wirklich absolut ausreichend und mit Begeisterung bei der Sache - sowie die Angehörigen und Teilnehmer des eine Dreiviertelstunde später stattfindenden Zehners im Start- und später im Zielbereich läuft man nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchs Fürstentum. Auch dann, wenn man nicht gerade wieder in einem Tunnel ist, wie unter dem Spielkasino hindurch.
Als sie wieder ans Tageslicht kommen, schwenken die Marathonis dann endlich auch auf die Original-Grand-Prix-Strecke ein. An dieser Stelle kommen sonst die überzüchteten Rennmaschinen mit irrer Geschwindigkeit den Hang herunter gerast. Nun machen die Läufer hier eine 180-Grad-Kehre, um wieder zurück zum Start zu gelangen.
 |
 |
 |
Wirklich nur kurz ist das Gastspiel im Hellen und schon lernt man wieder eine dunkle Seite Monacos kennen. Wieder ein Tunnel, diesmal ein legendärer. Denn der sogenannte Hafentunnel ist bei den Rennfahrern, die den engen Stadtkurs im Fürstentum sowieso meist überhaupt nicht mögen, aufgrund der plötzlich wechselnden Lichtverhältnisse regelrecht gefürchtet. Dabei ist das gar kein richtiger Tunnel, eher eine Galerie. Denn man läuft nur unter einem Gebäude, das Hotel und Tagungszentrum "Les Spélugues", das ins Meer hinaus gebaut wurde und auf den nun links sichtbaren Säulenreihen ruht. Wo an Land kein Platz mehr ist, muss man eben aufs Wasser ausweichen.
Die Jachten im Hafen auf der anderen Seite kann man dann aber wirklich ungestört betrachten. Man war ja inzwischen auch lange genug unter der Erde. Was da an "Booten" am Pier herum liegt, lässt so manches Mehrfamilienhaus winzig erscheinen. Falls die Inhaber in Monaco ansässig sind, tragen sie sicher ihren Teil zur hohen Millionärsquote bei. Drüben auf der gegenüber liegenden Seite des mit Schiffen vollgestopften Beckens ist wieder die felsige Halbinsel der Altstadt zu sehen, von der die Grimaldi seit 1419 endgültig ihren Ministaat beherrschten. Kaum ein Dynastie konnte sich länger halten. Wobei die männliche Linie schon mehrfach beendet war, die Eingeheirateten aber der Einfachheit halber den Familiennamen Grimaldi übernahmen.
Spätestens seit der Anerkennung der Unabhängigkeit 1489 durch den König von Frankreich war Monaco dann auch wirklich ein vollwertiger Staat. Und die Grimaldi machten nun internationale Politik. Richtig war dabei einzig und allein, was Monaco nutzte. Hinterher fragt schließlich niemand mehr nach den genauen Details, nur das Ergebnis zählt. Monaco lehnte sich mal hier, mal da an. Monaco suchte auf ganz unterschiedlichen Seiten Halt und Geborgenheit. Monaco spielte gelegentlich regelrecht mit den anderen. Monaco taktierte, um dann doch wieder urplötzlich die Richtung komplett zu ändern, um auch einmal Freunde zu versetzen und Vertraute vor den Kopf zu stoßen. Wer heute noch als Bündnispartner Bedeutung zu haben schien und der Principauté beistand, konnte morgen schon mit völliger Missachtung gestraft werden. Nicht immer war das in Monaco gesetzte Vertrauen gerechtfertigt. Eben Pech gehabt. Alles was zählte, war Monaco. Hauptsache, Monaco ging es gut.
So mogelte sich die Principauté irgendwie an fast allen großen Schwierigkeiten und Krisen vorbei. Manche der Mitstreiter sind längst zugrunde gegangen. Die Grimaldi dagegen sind trotz einiger Rückschläge immer wieder auf die Füße gefallen, konnten sich stets irgendwie durchlavieren und behaupten. Nicht immer ganz ehrenhaft und mit offenem Visier, aber eben erfolgreich.
Die Schleife am Hafen zieht sich fast einen Kilometer. Unten am Wasser hin, ein Stück weiter landeinwärts zurück erreicht man wieder den Startbereich. Kurz dahinter wartet die Markierung mit der "4". Noch einmal geht es leicht den Berg hinauf und dann scharf rechts hinein in die langgezogene Tunnelpassage. Das ist keine einfache Röhre. Unter der Erde gibt es Abzweige, Rampen, Auffahrten. Teilweise in mehreren Ebenen verlaufen die Straßen kreuz und quer durch den Berg. Sich hier zurecht zu finden ist nicht ganz einfach. Monaco ist kaum zu verstehen. Monaco ist unglaublich kompliziert. Monaco ist alles andere als eindimensional.
Zum Lesen des Stadtplanes braucht man ganz im Gegenteil ein wirklich gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Denn welche Straße jetzt von oben oder unter welche andere wie kreuzt, ist nicht immer auf den ersten Blick einsichtig. Und atemberaubende Folgen von Spitzkehren lassen schon beim Kartenlesen Schwindelgefühle entstehen. Monaco verdreht den Kopf. Monaco sorgt für ständiges Auf und Ab. Monaco heißt Achterbahnfahren.
Ein Netz von kostenlosen öffentlichen Aufzügen (Ascenseurs) und Rolltreppen (Escalators) verbindet die verschiedenen Ebenen. Das macht die Sache dann auch nicht leichter. Die unzähligen Treppen (Escaliers) dazwischen muss man noch mit eigener Kraft erklimmen, bieten aber für Fußgänger auch oft deutliche Abkürzungsmöglichkeiten. Auf die Idee, darauf wie anderenorts einen Berglauf zu veranstalten, ist man allerdings noch nicht gekommen. Die letzten zwei Kilometer im Fürstentum können die Marathonis dann endlich einmal jenen seltsamen Gebäudemix begutachten, der so typisch für Monaco ist. Denn nachdem sie zum zweiten Mal unter dem Kasino wieder aufgetaucht sind, wartet so schnell kein Tunnel mehr auf sie.
 |
 |
 |
Da stehen hässliche Wohnblocks aus den Sechzigern und Siebzigern neben - aus heutiger Sicht - deutlich gelungeneren Hochhäusern neueren Datums. Dazwischen quetschen sich allerdings auch immer wieder Villen aus der Belle Epoque, als es im Fürstentum noch ein wenig mehr Platz gab, in unterschiedlichsten Baustilen und in bunten Farben bemalt. Zwar herrschen französische und italienische Elemente vor. Doch auch spanisch-maurische Säulen oder britisch angehauchte Victorians mit Türmchen, Erkern und Giebeln kann man entdecken. Monaco bietet ständig anderes. Monaco ist völlig unstet, regelrecht sprunghaft. Monaco kann man überhaupt nicht einordnen. Monaco ist manchmal reizend, richtig liebenswert und wenig später einfach nur scheußlich und abstoßend.
Kurz hinter Kilometer sieben geht es über eine in verwirrenden Schleifen liegende Brückenkonstruktion heftig bergan. Und gleichzeitig hinaus aus Monaco und hinein nach Frankreich. Roquebrune - Cap Martin ist der Doppelname der Gemeinde, die sich nahtlos an das Fürstentum anschließt. Und doch merkt man den Übergang - nicht nur aufgrund des Ortsschildes - sofort. Denn die Bebauung hat sich auf einen Schlag geändert. Da gibt es jetzt Vorgärten, Bäume, Sträucher, unbebautes Gelände. Da klebt nicht mehr ein Haus am anderen. Da wirkt nichts mehr gedrängt. Hier kann schließlich auch eine Einwohnerzahl, die nur ein Drittel so groß ist wie die von Monaco, sich auf die fünffache Fläche verteilen.
Langsam, aber stetig steigt die Straße nun weiter an. Bis auf etwa achtzig Meter über dem Meeresspiegel gilt es zu klettern. Monaco selbst hat nur ein Viertel davon geliefert, die Brückenrampe ein weiteres. Die noch fehlende Hälfte sammelt sich dann bis zum Erreichen der nach Südosten ins Meer hinaus ragenden Halbinsel Cap Martin an. Da man bis dahin allerdings mehrere Kilometer hat, ist alles nicht ganz so dramatisch. Nach dem Umrunden eines Felsvorsprunges können die Marathonis dann hoch oben am Hang auch den zweiten Namensgeber der Doppelgemeinde kleben sehen - Roquebrune. Ein typisches village perché, wie man es im Hinterland der Côte d'Azur finden kann.
Roccabruna - übersetzt "Brauner Felsen" - ist der eigentliche Ursprung der Gemeinde. "Cap Martin" kam erst dazu, als der Tourismus auf der vorgelagerten Halbinsel Einzug hielt und die Bewohnerzahlen der Siedlungen unten am Meer irgendwann die des Dorfes auf dem Berg deutlich übertrafen. Und Roquebrune ist der absolute Gegenentwurf zu Monaco mit seiner hektischen Suche nach dem Glück. Denn hier - kaum mehr als einen Steinwurf von der Stadtgrenze entfernt - findet man eine völlig anderen Welt vor. Hier gehen die Uhren anders, sie gehen langsamer, ruhiger. Hier scheint die Zeit sogar stehen geblieben zu sein.
Unscheinbar, bescheiden, nahezu unberührt wartet Roquebrune oben auf seinem Felsen darauf entdeckt zu werden. Still und verträumt liegen die schmalen, oft von Häusern überbauten, mittelalterlichen Treppengassen da. Doch nur wenige Besucher verirren sich hierher. Kaum jemand nimmt Notiz vom Dörfchen, bei dem zugegebenermaßen schon an einigen Stellen der Lack etwas ab ist. Einige Ecken sind sogar ziemlich lädiert. Auf der anderen, der westlichen Seite von Monaco, gibt es kaum weiter entfernt mit Èze ein weiteres dieser Dörfer. Noch ein wenig spektakulärer, insbesondere von der Lage her, trifft man dort schon eher auf Touristen. Etliche Kunstgewerbegeschäfte in den Gässchen finden ihre Kunden. Roquebrune kann nicht einmal das bieten. Es ist noch ursprünglicher, fast könnte man sagen zurückgebliebener, aber halt absolut echt, offen und ehrlich.
Die Geschichte und das Bild des Dörfchens könnte auch ganz anders aussehen. Denn Roquebrune war einmal mit Monaco verbunden. Eine Zeit lang bestimmten die Grimaldi die Geschicke des benachbarten village perché. Erst 1861 gab Fürst Charles III das Dorf nach einigem Hin und Her endgültig an Frankreich ab. Wenn man bei der Principauté geblieben wäre, hätten die umtriebigen Regenten hier sicher einiges umgestaltet. Ob zum Besseren? Wer weiß.
 |
 |
 |
Die Marathonis bekommen es nur aus der Ferne zu Gesicht. Ihr Kurs bleibt unterhalb. Der weite Bogen, den man dabei hinaus zum Cap Martin schlägt, erlaubt nach zehn Kilometern erste Blicke hinüber auf den Startort Monaco. Und wie erwartet ist es eine ganze afrikanische Armada, die diese Aussicht zuerst hat. Die Kenianer Joel Kiplimo Kemboi, Henry Tarus, Stanley Kiprotich Rono, Jacob Kitur und Geoffrey Mutai sind geführt von ihren Landsleuten James Kipkemboi und Dominic Ruto nach 31:30 an der Zwischenzeitnahme. Nur der Äthiopier Folisho Tum Tuko rollt noch im Kenia-Express mit. Die zweite durch die Russen Sergey Fedotov und Andrei Bryzgalov sowie Aliaksey Haurychenka aus Belorussland eher osteuropäisch geprägte Gruppe hängt schon über eine Minute zurück. Und auch hier gibt es mit Girmay Ayane Kidanu (ETH) und Patrick Chumba Kimeli (KEN) weitere Afrikaner, die sich um das Preisgeld bewerben. Wer bei den Siegern des Rennens auf "noir" gesetzt hätte, konnte eigentlich kaum daneben liegen.
Bei den Damen ist allerdings russisch die dominierende Sprache. Gleich vier Frauen aus dem Land, dessen Weite doch eigentlich so gar nicht zur Enge Monacos passen will, liegen hier innerhalb einer Minute an der Spitze. Elena Tikhonova, Elena Kozhevnikova, Jeanna Malkova und Nadezda Semiletova lösen zwischen 38:14 und 39:18 nacheinander den Piepton aus. Bis die Niederländerin Kristijna Loonen, Anfang März bereits in Antalya siegreich, als nächste durchkommt, vergeht eine weitere Minute.
Von hier aus sieht das Fürstentum fast noch beengter aus. Ein unentwirrbares Knäuel aus Beton. Und viel größer als "nur" dreißigtausend Einwohner. Doch das oberhalb liegende, französische Beausoleil ist längst vollkommen mit Monaco verwachsen. Die Grenzlinie kann man auch aus nächster Nähe überhaupt nicht bemerken. Manche Straße wechselt in ihrem Verlauf sogar mehrfach die Seite. Nicht alles, was von der Ferne nach Monaco aussieht, ist also auch das echte Monaco. Aus der Distanz wirkt Monaco beeindruckender, als es vielleicht in Wahrheit ist.
Die Strecke verlässt die Hauptstraße und macht noch einen Schlenker hinaus auf die Halbinsel. Die eine oder andere Villa mit dem sie umgebenden Park kann man dabei noch en passant begutachten. Dort wo die fleißigen Helfer nach 12,5 Kilometern Schwämme verteilen, ist der höchste Punkt erreicht und die Straße beginnt sich zu senken. Keine zwei Kilometer später wird man wieder auf Meeresniveau angelangt sein. Was auf der Karte dabei wie eine Schleife, die von den Läufern um einen Kreisel zu drehen wäre, aussah, erweist sich in der Realität als kurzer Kehrtunnel, mit dem man im Fels weitere Höhenmeter verliert. Es wird allerdings der einzige Tunnel im französischen Teil des Kurses bleiben.
Schnurgerade zieht sich die Uferpromenade von Menton kilometerweit am Mittelmeer entlang. Der Marathon folgt ihr auf der kompletten Länge. Rechts das Mittelmeer, links Hotels, Restaurants, Geschäfte. Und ein Spielkasino. Nicht so nobel, nicht so bekannt wie das in Monaco. Eher für den Hausgebrauch. Doch seit man erkannt hatte, dass man durch das Spiel mit den Träumen, den Hoffnungen und dem vermeintlichen Glück der anderen etwas für sich erreichen konnte, rollte die Kugel und flogen die Karten auch im französischen Bereich der Côte d'Azur. Verschwistert ist man passender Weise mit Baden-Baden. Und mit Montreux im Schweizer Kanton Vaud. Wieder so eine Verbindung zur ähnlich populären Region am Genfer See. Ja, selbst die Marathons des IOC-Sitzes Lausanne und des IAAF-Sitzes Monaco ähneln sich zumindest aufgrund der Streckenführung über einen Wendepunktkurs auf der Uferstraße ziemlich.
Die fast endlose Reihe der Hotels wird durch mittelalterliche Häuser abgelöst, die sich einem kleinen Hügel um den hochaufragenden Kirchturm drängen. Die Altstadt von Menton hat nicht nur aufgrund des Baustils sondern auch dank der warmen Pastellfarben, mit denen die Gebäude gestrichen sind, schon durchaus etwas italienisch. Gelb, ocker, orange und rot dominieren. Für das Grün sorgen die Gärten, für die das früher genuesische Mentone aufgrund seines selbst für Riviera-Verhältnisse besonders milden Klimas bekannt ist.
Auch das letzte Städtchen auf der französischen Seite der Riviera gehörte übrigens einmal zur Herrschaft der Grimaldi und kam erst Mitte des neunzehnten Jahrhunderts an die Grande Nation. Zumindest aus historischer Sicht ist der Marathon also sehr wohl ziemlich monegassisch. Nicht vollständig allerdings. Denn Ventimiglia, die letzte Gemeinde, die vom Lauf berührt wird, gehörte nie zum Herrschaftsbereich der Grimaldi. Die Grafen der Stadt waren sogar eine Zeit lang erbitterte Konkurrenten der Fürsten von Monaco. Danach gehörte man zu Genua, Sardinien und eben schließlich Italien. Jetzt gehört man zum vereinten Europa. Denn wenn nicht das Schild "Italia 1000 m" am Straßenrand darauf hinweisen würde und das ehemalige Zollgebäude noch stünde, bekäme man den Grenzübertritt gar nicht richtig mit.
 |
 |
 |
Die Passage in "Bella Italia" erklärt dann auch den Plural im "des" beim "Marathon de Monaco et des Riviera". Denn nicht nur die French Riviera, wie man im englischsprachigen Raum die Côte d'Azur zu nennen pflegt, sondern auch die italienische wird für ein kurzes Stück berührt. Der Wegfall der Kontrollen aufgrund des Schengener Abkommens hat die riesige Dachkonstruktion des Grenzgebäudes eigentlich überflüssig gemacht. Am Marathonsonntag kann man die noch vorhandene Logistik allerdings ziemlich praktisch für die Verpflegungsstellen in der Nähe der Kilometer 20 und 25 nutzen. Die Abstände von fünf Kilometern zwischen den Versorgungsposten hält man trotz der immer drohenden Wärme auch ziemlich genau ein. An den Wasserstellen, die 2,5 Kilometer später folgen, gibt es tatsächlich nichts anderes als Schwämme.
Italien beginnt mit einem Tunnel. Was in Frankreich so selten war, wird auf dem italienischen Streckenteil wieder normal. Rund die Hälfte jener ziemlich genau fünf Kilometer läuft man nun wieder unter der Erde. Die auffällige, hohe und steil ins Meer abfallende Felsnase, die Menton von Ventimiglia trennt, ist allerdings auch kaum anders zu umgehen. Und es geht wieder bergauf. Nicht mehr so weit wie in Cap Martin, aber ganz so flach wie gerade eben noch entlang der Promenade de Soleil ist es eben auch nicht mehr.
Halbzeit ist allerdings im Freien. Verändert hat sich dort im Spitzenbereich nicht viel. James Kipkemboi hat als Hase seinen Job erledigt, eine 1:06 vorgelegt und lässt sich jetzt aus der Gruppe herausfallen, um ins Begleitfahrzeug zu steigen. Und der einzige Nicht-Kenianer Folisho Tum Tuko hat sich schon früher verabschiedet. Der Äthiopier folgt jetzt mit bereits einer Minute Rückstand. Das osteuropäische Trio folgt - nun ohne schwarzafrikanischen Anhang - weitere zwei Minuten später. Wer jetzt auf einen Sieger setzen möchte, der nicht aus dem kenianischen Hochland stammt, erhält sicher gigantische Quoten. Doch eine echte Vorentscheidung über den Gewinner ist noch nicht gefallen. Das Spiel ist weiterhin offen. Die Kugel rollt noch.
Recht sicher dürfte auch die Wette sein, falls man auf eine russische Siegerin tippt. Elena Tikhonova sitzt der führende Elena Kozhevnikova im Nacken. Beide sind noch unter 1:20 durch. Jeanna Malkova und Nadezda Semiletova brauchen gute zwei Minuten mehr. Doch Kristijna Loonen, die 2007 in Barcelona siegreich war, hat bereits weitere vier Minuten Rückstand.
Zwar wird Ventimiglia immer als vierte vom Marathon de Monaco passierte Stadt angegeben. Doch in Wahrheit bekommen die Läufer sie nie zu sehen. Selbst Latte, das erste zur italienischen Grenzstadt gehörende Örtchen wird nicht ganz erreicht. Der Name weckt gerade angesichts des schönen Wetters irgendwie schon ein wenig das Bedürfnis auf ein gemütliches Straßencafé. Doch zu einem Milchkaffee, einem Cappuccino oder eben einem Latte Macchiato kommt es nicht, so sehr sich das mancher Läufer inzwischen auch wünschen würde.
Mitten auf der Hauptstraße ist der Wendepunkt und nach knapp 23 Kilometern geht es zurück Richtung Monaco. Wenig später ist dann auch der kurze Ausflug nach Italien schon beendet und Menton wieder erreicht. Nicht auf der Hauptstraße wie auf dem Hinweg, sondern direkt unten am Hafen wird die Altstadt diesmal passiert. Die in den ausgedehnten Becken liegenden Boote könnten zum Teil durchaus beeindrucken. Doch von Monaco ist man eben etwas ganz anderes gewohnt. Da muss alles andere im direkten Vergleich zuerst einmal drastisch abfallen.
Fast zwei Kilometer lang umrundet man die Anlegeplätze, bevor man an der alten Hafenbastion wieder auf die Promenade du Soleil einbiegt. Der Springbrunnen, den man schon vor zehn Kilometern bewundern konnte, sprudelt immer noch. Auch er war immer in Bewegung. Doch im Gegensatz zu den Marathonis stets am gleichen Platz. Zumindest ein wenig Stimmung am Streckenrand gibt es hier. Immerhin ein paar Zuschauer sind bewusst wegen des Marathons gekommen und nicht nur zufällig hinein geraten. Doch so richtige Gänsehautatmosphäre gibt es nirgends. Auch Verkleidungen, die anderswo in Frankreich wie zum Beispiel beim bekannten Marathon du Medoc sowie seinen kleinen Brüdern dem Marathon des Premières Côtes de Blaye, dem Marathon du Cognac oder auch dem Marathon du Beaujolais Nouveau, die jene Veranstaltung fast zu laufenden Karnevalsumzügen machen, sind die absolute Ausnahme. Der einsame Pausenclown, der sich auf die Strecke begeben hat, scheint dann auch eher vom alljährlich im Januar stattfindenden Zirkusfestival von Monaco übrig geblieben zu sein.
 |
 |
 |
Die Sonne ist ein ganzes Stück nach oben gewandert. Und mit ihr auch die Quecksilberanzeige. Verbunden mit dem nun von vorne kommenden Wind sowie den bereits in den Beinen angesammelten Kilometern wird die Sache langsam zäher. Etliche Hoffnungen zerbröseln allmählich oder haben sich bereits völlig in Luft aufgelöst. Bei manchen geht es nur noch darum, überhaupt irgendwie weiter zu machen und nicht völlig aufzugeben. Langsam fängt die Zeit der Leiden an. Für einige hat sie längst schon begonnen. Die bekannte Frage nach dem "warum, wieso, weshalb" taucht jetzt öfter auf. Zumal Läufern mit nicht ganz so schlechtem Gedächtnis so manches irgendwie bekannt vorkommen dürfte. Und nicht alle Erinnerungen sind aufbauend. Einige bedrücken eher.
Das Gefälle, das man da vorhin so schwungvoll zur Strandpromenade von Menton hinunter geflogen ist, kommt nämlich jetzt zum Beispiel als Steigung daher. Eine heftige Rampe jenseits der Dreißig-Kilometer-Marke, die weitere der eigentlich gar nicht mehr wirklich vorhandenen Kräfte kostet. Da helfen auch die drei Mandolinen- und Gitarrenspieler nicht, die am Straßenrand das passende "Azuro" klimpern. Sie haben sich so geschickt gesetzt, dass man die Melodie den gesamten Kehrtunnel hindurch hören kann.
Noch immer ist der Kenia-Express für eine 2:12 genau im Fahrplan. Und noch immer ist er fünf Waggons stark, als es in diesen Anstieg hinein geht. Joel Kiplimo Kemboi, Henry Tarus, Stanley Kiprotich Rono, Jacob Kitur und Geoffrey Mutai heißen sie. Noch immer hat keiner von ihnen all seine Karten offen auf den Tisch gelegt. Noch immer hat keiner wirklich alles eingesetzt. Noch immer ist das "Rien ne va plus" nicht ertönt. Die Nummern 4, 5, 10, 11, 13 sind weiter im Spiel.
Der einsame Folisho Tum Tuko hat sich auf den letzten zehn Kilometern eine weitere Minute Rückstand eingehandelt. Und das russisch-belorussische Trio hängt schon fast fünf Minuten zurück. Ihre Landsfrauen haben dagegen schon mal ihre Positionen untereinander abgesteckt. In der Reihenfolge Elena Kozhevnikova, Elena Tikhonova, Jeanna Malkova und Nadezda Semiletova kommen sie jeweils im Zwei-Minuten-Abstand vorbei. Kristijna Loonen hat bei neun Minuten zur Führenden mit dem Ausgang ganz vorne anscheinend nichts mehr zu tun.
In Monaco sind inzwischen die ersten Läufer des Zehners längst im Stade Louis II eingelaufen. Benannt ist das 1985 eröffnete Stadion nach dem Sohn des ersten und Urgroßvater des zweiten Albert, der das Fürstentum zwischen 1922 und 1949 regierte. Auch er mit zwiespältigen Charaktereigenschaften und einer typischen, ziemlich verworrenen Grimaldi-Geschichte ausgestattet, die nicht nur heute die Klatschpresse interessieren würde, sondern es auch zur damaligen Zeit tat. Nach der frühen Scheidung seiner Eltern in Deutschland aufgewachsen, besuchte er dann ein Internat in Frankreich und kam erst spät wieder zu seinem Vater nach Monaco zurück. Ein Zugvogel, der nirgendwo richtig daheim war. Später ging er zur französischen Armee, kämpfte im ersten Weltkrieg für Frankreich, paktierte dann aber im zweiten mit den Nazis, die etliche ihrer internationalen Geschäfte über Scheinfirmen im Fürstentum abwickelten. Nach der Landung alliierter Truppen an der Côte d'Azur wechselte Louis jedoch schnell wieder die Seiten. Monaco setzt eben auf Gewinner. Monaco gibt sich mit den Verlierern nicht mehr ab.
Auch was Gefühle anging, legte er für sich völlig andere Maßstäbe an als für andere. Für ihn galten eigene Regeln. Seinem Verhältnis mit einer algerischen Wäscherin, die er während seiner Dienstzeit in Nordafrika kennen gelernt hatte, entstammte seine einzige Tochter Charlotte, die er später adoptierte, um den Fortbestand der Dynastie zu sichern. Charlotte wurde dann - ganz wichtig - völlig standesgemäß mit einem französischen Adligen verheiratet. Und als seine Enkelin Antoinette, die Schwester des späteren Fürsten und Louis' Nachfolger Rainier, ein Techtelmechtel mit einem deutschen Unteroffizier begann, sorgte er dafür, dass dieser sich schnell an der Ostfront wieder fand. Der war nämlich absolut nicht standesgemäß genug.
 |
 |
 |
Nur wenig später heiratete der greise Fürst übrigens eine dreißig Jahre jüngere Schauspielerin aus ziemlich bürgerlichen Verhältnissen. Wohl kaum standesgemäßer. Bei weitem nicht alles, was er sich selbst im emotionalen Bereich zugestand, ließ er eben auch bei seinen Mitmenschen gelten. Sofortiges Loslassen erwartete Prince Louis nur von den anderen.
Das auf den Namen dieses seltsamen und doch für Monaco nicht völlig ungewöhnlichen Herrschers getaufte Stadion erreicht der Marokkaner Ouerdi Zouhair nach 31:52 als Erster. Die nächsten beiden haben zwar als Nationalität "FRA" in der Ergebnisliste stehen. Doch die Namen von Boualem Tigre (32:35) und Mohamed Alayhyan (33:05) weisen sehr wohl ebenfalls auf nordafrikanische Wurzeln hin. Wurzeln, die auch Mustapha Charki, Fünfter in 33:36, haben dürfte. Der schnellste Läufer des AS Monaco ist allerdings ebenfalls Franzose und kein echter Monegasse. Der Erste, der auch die Staatsangehörigkeit des Fürstentums besitzt, ist Jean Marc Rue, dessen 36:48 den Marathonlandesrekord durchaus nicht unerreichbar scheinen lassen.
Die Zeiten der schnellsten Frauen sind deutlich schwächer. Die Italienerin Michela Beltrando löst erst nach 40:47 die Zeitnahme aus. Doch spannend ist es. Denn zehn Sekunden später ist Yvanna Garreau aus Nizza durch. Und nur noch weitere sechs Sekunden dauert es, bis Jasmina Glad die Matte zum Piepen bringt. Die gebürtige Finnin arbeitet übrigens im Büro der IAAF. Völlig am Verband vorbei geht der Marathon dann also doch nicht.
Drüben auf der anderen Seite der Stadt fällt langsam doch eine Entscheidung. Kiprotich Rono ist schon abgehängt. Und auch Henry Tarus verliert nun den Anschluss. Die Kugel, die sich im Kessel weiter dreht, wird jetzt entweder in die 4, in die 10 oder in die 11 fallen.
Nur noch zu dritt sind Mutai, Kitur und Kiplino Kemboi an der Spitze, als links unter ihnen die roten Sandplätze des Monte Carlo Country Clubs auftauchen, wo sich Ende April die Tennisasse um ein deutlich höheres Preisgeld streiten werden. Übrigens auf französischem Territorium, denn für Tennisplätze ist im Fürstentum kein Platz. Schon gar nicht für so viele. Außer dem Stadion findet man überhaupt kein richtiges Sportgelände auf dem Stadtplan.
Nach der schon bekannten Brückenrampe liegt das Tennisstadion dann über den Marathonis. Und noch weiter geht es steil bergab, hinunter in Richtung Mittelmeer. Fünfzig Meter auf weniger als einem Kilometer. Das letzte Stück des Marathons wird größtenteils direkt am Ufer zurückgelegt. Gleich mehrere neugebaute, klotzige Hotels empfangen die Läufer zurück im Fürstentum. Direkt hinter der Grenze erhebt sich das Monte Carlo Bay Hotel mit über 300 Zimmern, für die man selbst im günstigsten Fall mehrere hundert Euro pro Nacht hinlegt. Doch man hat ja auch ein hausinternes Spielkasino.
Nicht nur im altehrwürdigen Prachtbau spielt man in Monaco mit der Hoffnung auf einen Hauptgewinn. Gleich mehrere Ableger hat die Betreiberin Société des Bains de Mer, längst mit etlichen Hotels und Restaurants ein regelrechter Tourismuskonzern, geschaffen. Dass man Glücksspiel unter einem Dach mit Unterhaltung und Übernachtung kombinieren kann, hat man sich allerdings in Las Vegas abgeschaut. Avenue Princesse Grace heißt diese Straße. Und über deren Namensgeberin muss man wohl kaum noch viele Worte verlieren. Ihre Bronzestatue in der Grünanlage am Rand blickt genau in die passende Richtung, um den entscheidenden Vorstoß von Geoffrey Mutai zu sehen. Denn auf dem Weg zu Kilometer 39 kann sich der Kenianer von seinen letzten beiden Mitstreitern lösen. Es sieht danach aus, als ob die Kugel ins Feld mit der 4 fallen würde.
 |
 |
 |
Den kleinen Strand von Larvotto haben sie da gerade hinter sich gelassen. Links taucht eine ungewöhnliche Glas-Metall-Konstruktion vor ihnen auf, das Grimaldi Forum. Mit dem zur Jahrtausendwende fertig gestellten neuen Konferenzzentrum - immerhin bereits das zweite im Zwergstaat neben "Les Spélugues" - versucht man die Position als Kongressstadt zu festigen und auszubauen. Ein zusätzliches Standbein, falls das Geschäft mit Spiel irgendwann doch nicht mehr laufen sollte.
Welch ein Kontrast zum "Musée National" auf der anderen Straßenseite. Denn das ist in einer Villa untergebracht, die zwischen all den modernen Neubauten um sie herum fast ein wenig deplaziert wirkt. Irgendwie ist das Nationalmuseum auch ein Kuriosum. Denn nicht etwa Historisches aus der immerhin bis in die Antike zurückreichende Siedlungsgeschichte zeigt man hier. Und auch keine wertvollen Kunstgegenstände, Gemälde oder Statuen. Nein, hier kann man Spielzeug betrachten. Hauptsächlich Puppen und Spielautomaten. Und doch ist es auch ein wenig bezeichnend für einen Staat, der eben untrennbar mit dem Spiel verbunden ist. So untrennbar, dass selbst ein mathematisches Zufallsverfahren "Monte-Carlo-Simulation" getauft wurde. Manchmal wäre es vielleicht auch besser, wenn man mit Puppen statt mit richtigen Menschen spielen würde.
Nachdem man dann auch die Mauer passiert hat, hinter der sich der kleine japanische Garten verbirgt, kommt der Hafentunnel wieder in Sicht. Als Oase der Stille mitten im Großstadtgetümmel kann man hier zwischen Wasserläufen, Brücken und nachgemachten Tempelchen dann doch ein wenig Abstand von der Hektik und dem Gewusel finden, die im Rest von Monaco vorherrschen. Die Ungeduld ist anscheinend so groß, dass bei einigen Fußgängerampeln eine digitale Sanduhr neben dem Männchen zeigt, wann die Farbe den endlich auf Grün wechselt. Monaco muss eben ständig in Bewegung sein. Monaco scharrt unentwegt mit den Hufen. Monaco kann einfach nicht warten.
Hier endet dann auch die kurze Uferpromenade, die um das Kongresszentrum herum hinüber zu den Strandcafés von Larvotto führt. Eine der wenigen Stellen an denen sich im Fürstentum Fußgänger fernab des Straßenverkehrs zumindest ein wenig die Beine vertreten können. Zudem ist es - völlig ungewöhnlich für den Stadtstaat - auch noch ziemlich eben. Monaco bietet eben immer wieder neue Überraschungen. Monaco ist eigentlich nie genau so, wie man es gerade erwartet. Und wenn man glaubt Monaco verstanden zu haben, entdeckt man im nächsten Moment eine neue Seite.
Diesmal können die Marathonis zumindest einen etwas längeren Blick hinauf zur Spielbank werfen, auf die sie jetzt zulaufen. Man sieht allerdings keine ihrer prunkvollen Paradeseiten. Weder den dem Place du Casino zugewandten Haupteingang, noch die Rückfront auf der Terrasse hoch über dem Meer. Einzig einen Seitentrakt, in dem die Opernbühne untergebracht ist, kann man von unten erkennen. Das Herzstück Monacos zeigt den Läufern seit diesem Jahr endgültig nur noch die kalte Schulter. Zwar steht da sogar "Casino" als Werbeaufdruck auf der Startnummer. Doch der Sponsor, der da seinen Namen auf den Bildern vom Marathon sehen möchte, ist keineswegs das Spielkasino sondern eine französische Supermarktkette.
Nicht mehr lange wird es dauern, dann kann dort oben schon wieder das erste Geld riskiert werden. Ab zwölf Uhr hat man am Wochenende geöffnet. Aber zuerst einmal nur in den Räume mit den einarmigen Banditen. Bis die Salons mit den Roulette- oder Kartentischen öffnen, vergeht dann doch noch etwas mehr Zeit. Um dort dann die ganz hohen Einsätze tätigen - und dann wohl zumeist auch verlieren - zu können, braucht man allerdings die passende Kleidung. Jeans und Turnschuhe sind tabu, ohne Anzug oder Abendkleid geht gar nichts. Auch wenn man verliert und enttäuscht wird, weil man alles auf die Falsche - egal ob Karte, Zahl oder sonst etwas - gesetzt hat, Monaco erwartet einfach, dass man es mit perfektem Anstand tut. Und Uniformträger müssen ebenfalls draußen bleiben. Als Erklärung dafür gibt man gerne an, dass ausländische Kriegsschiffkapitäne, die im Kasino große Beträge verspielten, auch schon einmal mit roher Gewalt und dem Einsatz ihrer Kanonen gedroht hätten. In wie weit diese Geschichten der Wahrheit entsprechen, ist schwer nachzuprüfen. Monaco strickt manchmal gerne an seiner eigenen Legende.
Auf der Straße unterhalb des Kasinos werden ebenfalls viele Träume nicht mehr wahr. So mancher der in einem Anfall von Euphorie seine eigenen Möglichkeiten einfach überschätzte und ein viel zu hohes Risiko einging, schleppt sich jetzt völlig kraftlos dem Ziel entgegen. Eben Pech gehabt. Doch tut das dann einfach nur furchtbar weh. So mancher bisher gekämpfte, vermeintlich große Kampf erweist sich dann im Rückblick als ziemlich wertlos.
 |
 |
 |
Auch Stanley Kiprotich Rono geht es so. Der Marathondebütant aus Kenia, der drei Viertel der Distanz das Tempo mit bestimmt, bricht völlig ein und wird nach hinten durchgereicht. Zehn Minuten verliert er auf den letzten zehn Kilometern gegenüber seinem siegreichen Landsmann und wird am Ende nur als Achter in 2:22:09 gestoppt
Die Strecke am Hafen entlang kennen die Marathonis ja schon. Vor siebenunddreißig Kilometern sind sie hier schon einmal vorbei gekommen. Da war es allerdings weniger belebt. Inzwischen haben sich die Freiluftcafés gefüllt und unzählige Flaneure sind entlang der aufgereihten Luxusjachten unterwegs. Nicht immer nehmen sie dabei Rücksicht auf die inzwischen längst nicht mehr in dichten Pulks daherkommenden Läufer. Manchmal hilft wirklich nur noch ein lauter Ruf, um den drohenden Zusammenprall im letzten Moment zu verhindern. Dort wo bereits Leitplanken für den Grand Prix montiert sind, werden die Absperrungen dann fast selbstverständlich wieder besser. Noch einmal wird das Schwimmbecken umkurvt, das im Sommer mitten auf dem Kai zu Badevergnügen einlädt. Auch die Formel-Rennwagen müssen diese Links-Rechts-Rechts-Links-Kombination passieren. Und spätestens seit einer von ihnen hier abhob und in hohem Bogen im Hafenbecken landete, gilt diese Stelle des Kurses als besonders spektakulär.
Ganz so schnell, dass er abheben könnte, ist dann Geoffrey Mutai doch nicht. Aber schnell ist er. Sein Abstand auf die Verfolger ist inzwischen klar genug, um schon einmal an die ausgelobte Siegprämie denken zu können. Der Kenianer lässt sich die auch nicht mehr nehmen. Mit zwei nahezu identischen Hälften siegt er in - für den nicht ganz einfachen Kurs durchaus beachtlichen - 2:12:40. Die Kugel ist im Feld mit der schwarzen vier zum Liegen gekommen. Glück? Nein mit Zufall hatte das natürlich wenig zu tun. Das war Können.
Und doch auch Glück. Denn glücklich ist der Sieger mit Sicherheit. Das gewonnene, in Wahrheit aber wohl eher hart erarbeitete Preisgeld hat zu Hause schließlich einen ganz anderen Wert als im teuren Fürstentum. Angeblich genetische Vorteile hin, ständiges Training im Hochland her, die wahre Ursache für die Überlegenheit der ostafrikanischen Läufer ist wohl eher die Chance auf den sozialen Aufstieg.
Auch für Jacob Kitur und Joel Kiplimo Kemboi, die in 2:13:22 bzw. 2:13:50 die Plätze zwei und drei belegen, bleibt noch ein ordentlicher Betrag aus dem Prämientopf übrig. Kitur, der bereits bei der letzten Austragung im November 2006 Dritter wurde, verbessert seine Zeit von damals um volle fünf Minuten. Als Vierter biegt Henry Tarus in den Tunnel ein, der vom Hafen aus den Altstadthügel unterquert und in dem sich die vorletzte Kilometermarkierung befindet. Weder kann Tarus nach vorne etwas erreichen, noch droht ihm von hinten irgendwelche Gefahr. Also läuft er sein Rennen in 2:16:57 einfach nach Hause. Ganz so sicher kann der Solist Folisho Tum Tuko sich dagegen nicht fühlen, denn ihm rücken Fedotov und Haurychenka, die ihren dritten Mann Bryzgalov (2:23:15) inzwischen verloren haben, doch noch einmal etwas dichter auf die Pelle. Zwar hat der Äthipier am Ende mit 2:19:33 dann doch noch eine gute Minute zum Russen, der mit 2:20:40 gestoppt wird. Doch es waren unterwegs auch schon einmal drei. Haurychenka folgt knapp dahinter in 2:20:52.
 |
 |
 |
Gerade als die hier schon mit einem uneinholbaren Vorsprung führende Elena Kozhevnikova unter dem Schlossfelsen hindurchläuft, klicken oben die Kameras der Touristen bei der Wachablösung der Carabiniers du Prince. Noch so eine Geschichte, bei der Monaco den Leuten vormacht, das sei eine ernsthafte Angelegenheit. Man glaubt es, weil man es glauben möchte.
Dabei handelt es sich doch eigentlich nur um eine - in diesem Fall zudem auch noch ziemlich mittelmäßige - Inszenierung. Denn eine richtige Armee besitzt das Fürstentum überhaupt nicht. Und außer dem für die Fotografen Wachestehen vor dem Palais hat die Einheit - im Gegensatz zum Beispiel zu den britischen Garderegimentern - keine echte Aufgabe. Ein wenig Schau gehört in Monaco einfach dazu. Manches, was hier Avenue heißt, wäre anderswo noch nicht ein mal eine Rue sondern nur eine Ruelle, also eine Gasse. Monaco übertreibt halt gelegentlich ganz gerne. Monaco bauscht manches ziemlich auf. Monaco tut manchmal auch nur so als ob. Man gibt sich ja auch als Alpenstaat, hat sogar die Alpenkonvention unterzeichnet. Dabei nennt man gar keine echten Berge sein eigen. Schon gar keine richtig hohen.
Und Schnee kennt man eigentlich überhaupt nicht, nur etwa einmal pro Jahrzehnt bleibt er liegen. Monaco ist in Wahrheit Flachländer. Das Staatsgebiet endet bei gerade einmal 163 Meter Höhe. Die als chronisch tief liegend verschrienen Niederlande reichen an einer Stelle doppelt so weit nach oben. Den höchsten Punkt des Fürstentums findet man dann sicher nicht auf einem Gipfel sondern wohl auf dem Dach eines am Hang stehenden Hochhauses.
Die Marathonis haben nun den wirklich allerletzten Tunnel verlassen. Und sie haben Neuland betreten. Nicht nur weil sie diese Streckenteil noch nicht unter den Füßen hatten. Nein, richtiges Neuland. Vor vier Jahrzehnten war hier nichts als Wasser. Jetzt erhebt sich auf aufgeschüttetem Grund und Boden der Stadtteil Fontvieille. Monaco zeigt wieder einmal, wie man große Vorteile daraus zieht, dass man irgendwo all seinen Schutt abladen kann. Die Tatsache, dabei auch seine Umwelt ziemlich belastet zu haben, wird angesichts des Ergebnisses von Monaco gerne verdrängt.
Rechts, auf den Terrasses de Fontvieille könnten die Läufer später ein Museum besichtigen, das irgendwie auch wieder typisch für Monaco sind. Das Museum für Briefmarken und Münzen. Dinge, die das Fürstentum als weitere Quelle zum Geldverdienen entdeckt hat. Gerade monegassische Briefmarken werden viel mehr gedruckt, als je auf Briefe oder Postkarten geklebt werden können. Sie wandern allerdings zumeist auch direkt in die Alben der Sammler. So viel schreibt Monaco dann nun wirklich nicht. So viele Grüße kommen nicht aus Monaco. Und Münzen müsste man eigentlich überhaupt keine prägen. Denn wie Liechtenstein mit der Schweiz, hat Monaco schon seit ewigen Zeiten mit Frankreich eine Währungsunion. Und damit ist man auch als nicht EU-Mitglied Bestandteil der Eurozone. Doch natürlich hat man sowohl früher eigene Francs- wie jetzt auch Euromünzen hergestellt. Es gibt sogar mehrere Varianten. Die ersten mit Fürst Rainier, die neuen mit Albert auf der Rückseite. Im Umlauf sind von diesen Raritäten im Fürstentum dennoch keine. Auch die verschwinden, wenn man sie überhaupt je einmal in die Hand bekommt, sofort im Sammelalbum. Und die Sonderprägung mit Fürstin Gracia gilt schon als seltenste und wertvollste Euromünze überhaupt.
Von den Terrassen gelangt man auch in den winzigen Zoo von Monaco. Auch so etwas gehört ja zu einem richtigen Staat, auch wenn dafür eigentlich gar kein Platz ist. Ein wenig eingepfercht sind die Tiere am Hang unterhalb des Fürstenpalais schon. Moderne Zoos sehen eigentlich anders aus. Für Elefanten reicht es natürlich dennoch nicht. Doch die hätten mit ihrer Trägheit und ihrem legendären Gedächtnis ja wohl auch kaum zum flexiblen, sich ständig verändernden Monaco gepasst. Dafür wachsen aber an vielen Stellen der Stadt Elefantenbäume. Es wächst hier eigentlich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Palmen, Agaven, Kakteen in jeder beliebigen Größe und Farbe. Doch nicht nur im Fürstentum, überall an der Côte d'Azur. Der Exotengarten von Monaco, der sich über Fontvieille am Steihang erstreckt, ist bei weitem nicht der einzige in der Region.
 |
 |
 |
Der Siegerin Elena Kozhevnikova drückt man natürlich dennoch einen Blumenstrauß und keinen Kaktus in die Hand. Nach 2:41:21 ist die Russin im Ziel. Fast sieben Minuten konnte sie der bei Halbzeit nur wenige Sekunden hinter ihr liegenden Elena Tikhonova (2:48:10) am Ende abnehmen. Nachgelassen haben beide auf der zweiten Hälfte, eingebrochen ist nur Tikhonova, die fast zehn Minuten verliert. Jeanna Malkova kann den Abstand aber dennoch nicht verkürzen und läuft nach 2:50:37 ein.
Wesentlich besser eingeteilt hat sich Kristijna Loonen das Rennen. Sie kann beim zweiten Halbmarathon sogar noch ein paar Sekunden zulegen und die zum Ende fast Stehversuche machende Nadezda Semiletova (2:56:53) einsammeln. Auch Malkova kommt noch einmal in Sichtweite. Während die Russin unter dem Zieltransparent durchläuft, passiert die Niederländerin gerade die Tafel mit der 42. Im Ziel fehlen Loonen ganze 53 Sekunden zum Treppchen.
Bereits vor dem fünfzigsten Zieleinlauf springt die erste Stelle der Uhr auf eine drei. Und nur wenig mehr als die Hälfte der Ergebnisliste ausgewiesenen 1081 Läufer kommen unter vier Stunden an. Wobei der in der Ausschreibung angegebe und vom Stadionsprecher dann auch laut verkündete Zielschluss von 5:30 Stunden am Ende doch nicht so streng ausgelegt wird. Erst bei 5:50 findet sich der letzte Eintrag.
Neben der Medaille gibt es auch einen Chip für jeden. Doch den wird man in der Spielbank nicht los. Man bekommt ihn auch nicht in die Hand gedrückt, man hat ihn schon am Fuß. Der Versuch, das Zeitmessgerät, das man im Umschlag mit der Startnummer erhielt, wie anderswo im Ausland, wo man oft kostenlose Leihchips benutzt, direkt nach dem Zieleinlauf zurückzugeben, scheitert. Denn es war gar kein Leihchip. "C'est un Cadeau". Das war ein Geschenk. Deshalb also das aufgedruckte Logo mit der Startnummer. Monaco steckt wirklich voller seltsamer Überraschungen. Monaco ist manchmal wirklich vollkommen unberechenbar.
Lohnt es also, sich mit Monaco zu beschäftigen? Ist Monaco viele Gedanken wert? Nun wer sie einmal kennen gelernt und erlebt hat, wird sich natürlich weiter an die Pricipauté erinnern. Es mögen zum Teil recht seltsame Erinnerungen sein. Schöne und weniger schöne. Und einige, die man gar nicht richtig einordnen kann. Bereichernd sind sie aber sicherlich.
Ganz streichen von der Liste sollte man Monaco und seinen Marathon deshalb jedenfalls nicht. Man muss sie bestimmt nicht unbedingt lieben. Aber mögen könnte man sie ja durchaus.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Infos unter www.monaco-marathon.com Zurück zu REISEN + LAUFEN — aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.