

 |
 |
 |
 |
 |
 |
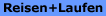 |
 |
 |
 |
 
|
 |
16. Ljublanski Maraton - Slowenien
|
 |
|
von Ralf Klink
|
"Wo ist denn Ljubljana?" In vier von fünf oder vielleicht sogar neun von zehn Fällen, geht das Gespräch so weiter, wenn hierzulande der Name dieser Stadt fällt. "Irgendwo im Osten", das kann man ja schließlich noch einigermaßen an den seltsamen Konsonantenkombinationen erkennen. Doch dann reichen die Schätzungen tatsächlich von Polen bis Bulgarien oder gar in die Ukraine. Eigentlich ist das enorm peinlich. Und es zeugt entweder bestenfalls von ziemlich mangelhaften geographischen und politischen Kenntnissen oder aber schlimmstenfalls sogar von einer gewissen Ignoranz und Überheblichkeit. Denn schließlich handelt es sich bei Ljubljana nicht nur um die Hauptstadt eines befreundeten Landes. Sie ist von Deutschland auch nicht weiter entfernt als Norditalien. Von München fährt man dorthin zum Beispiel genauso weit wie nach Frankfurt. Gerade einmal vierhundert Autobahnkilometer beträgt die Distanz.
 |
 |
| Vom Burgberg bietet sich nicht nur eine gute Aussicht über die Stadt, der Blick reicht sogar bis zu den gar nicht so weit entfernten Alpen | |
Doch selbst mit der Zusatzinformation, dass es sich bei dem betreffenden Staat um Slowenien handelt, sind einige noch nicht wirklich weiter gekommen. Es gibt da nämlich auch noch ein Land namens "Slowakei". Und mit schöner Regelmäßigkeit werden diese beiden durcheinander geworfen. Da kann man durchaus froh sein, dass es wenigstens um die kroatische Region Slawonien, die während der Jugoslawienkriege regelmäßig in den Medien auftauchte, ruhig geworden ist und so nicht noch mehr Verwirrung entsteht.
Zufällig sind diese Übereinstimmungen nicht. Denn in allen genannten Gegenden sind Menschen zu Hause, die slawische Sprachen benutzen, also jener neben der germanischen und romanischen dritten großen europäischen Sprachgruppen zugerechnet werden. Und in deren Eigenbezeichnungen tauchen eben immer wieder die Silben "slov" oder "slav" auf. Allgemein nimmt man an, dass damit ungefähr "die sich Verstehenden" oder "die miteinander Sprechenden" gemeint ist. Denn noch heute lautet der Begriff für "Wort" in einigen der Sprachen "slovo".
Abgegrenzt davon wurden dann diejenigen, mit denen man sich eben nicht verständigen konnte, weil sie zum Beispiel eine andere Sprache benutzen. Das galt natürlich in erster Linie für die benachbarten germanischen Völker. Und so haben die in den verschiedenen slawischen Sprachen für "die Deutschen" stehenden Bezeichnungen "Nemci", "Nijemci", "Nemci" oder "Niemcy" noch immer den gleichen Wortstamm wie der sprachlich eng verwandte jeweilige Ausdruck für "stumm".
Während die Slowakei sich östlich an Tschechien und Österreich anschließt, findet man Slowenien jedenfalls südlich der Alpenrepublik. Es ist der nördlichste der aus dem früheren Jugoslawien - noch so ein Name mit der erwähnten Silbe - entstandenen Staaten. Ungefähr so groß wie Hessen oder Rheinland-Pfalz ist das Ländchen, das man von Ljubljana aus regiert, hat allerdings gerade einmal zwei Millionen Einwohner.
 |
 |
| Direkt am Flüsschen Ljubljanica erstrecken sich zu Füßen des Burgberges die Markthallen der Stadt | |
Die Hauptstadt selbst zählt knapp dreihunderttausend Bewohner und ist damit eindeutig der wichtigste Ballungsraum des ansonsten eher ländlich geprägten Sloweniens. Ansonsten erreicht nämlich nur Maribor - mit etwas mehr als den dafür nötigen hunderttausend Bürgern - gerade noch den Status einer Großstadt. Wenig überraschend stellt Ljubljana also nicht nur politisches sondern auch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der jungen Republik dar.
Aus sportlicher Sicht ist Ljubljana dagegen ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. In den in der Publikumsgunst so dominierenden Mannschaftssportarten tauchen Vereine aus der Stadt bei internationalen Wettbewerben meist nicht auf, was sicher ein nicht unbedeutender Faktor für ihren fehlenden Bekanntheitsgrad im Ausland ist. Einzig im Basketball, dem in Südosteuropa eine recht hohe Bedeutung zukommt, spielt der vielfache nationale Titelträger KK Olimpija Ljubljana in der europäischen Eliteliga mit.
Das sieht beim auch in Slowenien noch wichtigeren Fußball dagegen ganz anders aus. Auch wenn zum Beispiel die ersten nach der Unabhängigkeit ausgespielten Meisterschaften in die Hauptstadt gingen, liegt der letzte Titelgewinn des ortansässigen Clubs NK Olimpija - nur durch die Buchstabenkombination lassen sich die den gleichen Namenszusatz tragenden Vereine Ljubljanas unterscheiden - nun schon eineinhalb Jahrzehnte zurück. Zwischenzeitlich musste er wegen finanzieller Probleme sogar aufgelöst und neu gegründet werden.
Und auch beim Handball bietet sich zumindest bei den Herren ein ähnliches Bild. Dort dominierte mit siebzehn von zwanzig möglichen Meisterschaften eindeutig der Verein aus dem mit fünfzigtausend Einwohnern auf Rang vier der nationalen Größenrangliste stehenden Celje. Dem im Frauenbereich ähnlich dominanten RK Krim sieht man zumindest nicht auf dem ersten Blick an, dass es sich dabei um ein Team aus einem Stadtteil von Ljubljana handelt.
Beide mischen auch auf europäischer Ebene vorne mit. Die Spielerinnen aus der Hauptstadt konnten schon zweimal die Champions League gewinnen und standen zudem dreimal im Finale, die Herren aus Celje holten sich immerhin einmal diese wichtigste Klubtrophäe. Ohnehin sind die Handballer vielleicht nicht die populärsten wohl aber die erfolgreichsten slowenischen Ballsportler. Die Männer unterlagen 2004 bei ihrem bisher größten Erfolg während der EM im eigenen Land sogar erst im Finale gegen Deutschland und holten damit Silber.
Ansonsten wird Slowenien im Ausland aber vermutlich doch eher als Wintersportland wahrgenommen. Schließlich gehört praktisch der gesamte Norden noch zum Alpenraum. Mehrere hundert Berge ragen dort über zweitausend Meter auf. Und so hat das kleine Land dann auch folgerichtig kaum weniger viele Medaillengewinner bei Winter- als bei Sommerspielen.
 |
 |
| Der Prešeren-Platz mit der Franziskanerkirche ist der eigentliche Mittelpunkt Ljubljanas | |
Doch hängt das verstärkte Registrieren slowenischer Athleten andererseits wohl auch hauptsächlich mit den stunden- ja manchmal beinahe tagelangen Fernsehübertragungen während der Monate November bis März zusammen, durch die den Eis- und Schneedisziplinen eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit zu Teil wird.
So kennt man hierzulande zwar die Skifahrer Tina Maze und Jure Košir oder die Skispringer Primož Peterka, Robert Kranjec und Jernej Damjan sowie Vater Miran und Sohn Jurij Tepeš. Von CopIztok Cop und Luka Špik oder Rajmond Debevec, die dem jungen Staat Slowenien die ersten olympischen Goldmedaillen beschert haben, dürfte dagegen noch nie jemand gehört haben.
Doch werden ihre Sportarten Rudern und Schießen ja eben auch nur alle vier Jahre für zwei Wochen kurz zur Kenntnis genommen - und das auch nur für den Fall, dass sie ausreichend Medaillen "liefern". Anschließend verschwinden sie dann bis zu den nächsten Olympischen Spielen dann wieder in der Versenkung. Kanuten, Fechtern, Ringern oder Judokas geht es ebenfalls nicht anders. Aber sogar in der "Kernsportart" Leichtathletik teilt Primož Kozmus, der in Peking immerhin Olympiasieger und ein Jahr später in Berlin Weltmeister im Hammerwerfen wurde, wohl das Schicksal seiner Hauptstadt.
Denn nur mit sehr viel Überlegen werden ihn die meisten überhaupt irgendwie mit Slowenien in Verbindung bringen. Vielen Fernsehsportlern sind der alpine Weltcuport Kranjska Gora, die Skisprungschanzen von Planica oder das Biathlonzentrum in Pokljuka jedenfalls wesentlich geläufiger als Ljubljana.
Und im Ausdauerbereich sind eben Skilangläuferin Petra Majdic oder Biathlet Klemen Bauer vielen durchaus ein Begriff. Von Mittelstrecklerin Jolanda Ceplak - immerhin auch schon mit olympischen Edelmetall bedacht - oder Marathonläuferin Helena Javornik - unter anderem schon in Wien, Florenz, Turin, Treviso und Amsterdam siegreich - haben dagegen nur absolute Spezialisten gehört. Da beide allerdings schon einmal wegen eines positiven EPO-Testes aus dem Verkehr gezogen wurden, kann man bei ihnen aber ohnehin kaum von Vorbildern sprechen.
Immerhin schon dreimal steht Javornik zudem in der Siegerliste des Ljubljana Marathons. Schließlich - fast möchte man sagen "natürlich" - wird auch in der slowenischen Kapitale über zweiundvierzig Kilometer gelaufen. Ein eigener Marathon gehört inzwischen ja fast schon zum Standardrepertoire im Veranstaltungsprogramm einer Großstadt.
Und was im serbischen Belgrad und dem kroatischen Zagreb oder auch in Podgorica und Skopje - den noch viel unbekannteren Hauptstädten von Montenegro und Mazedonien - möglich ist, sollte selbstverständlich auch im von allen Nachfolgerepubliken des ehemaligen Jugoslawien wirtschaftlich mit Abstand am besten dastehenden Slowenien möglich sein.
 |
 |
 |
| Die Nationalbibliothek befindet sich genauso mitten im Stadtzentrum … | …wie einige Fakultäten der Universität | |
Zum sechzehnten Mal wird dieser Lauf im Jahr 2011 gestartet. Als Veranstalter tritt dabei die Stadt Ljubljana selbst auf - die "Mestna obcina Ljubljana", wie es auch die englische Version des Internetauftrittes unter "Organizer" vermerkt. Natürlich verspricht sie sich davon einen gewissen Werbeeffekt und hofft insbesondere auch auf Lauftouristen aus dem Ausland. Andererseits sichert diese Konstellation dem Lauf allerdings wohl auch eine deutlich höhere Kontinuität als bei Ausrichtung durch eine an schnellen Gewinnen interessierte kommerzielle Agentur.
Der Erfolg gibt den Stadtvätern dabei durchaus recht. Während hierzulande die Teilnehmerzahlen immer weiter einbrechen, zeigen die zugehörigen Liniendiagramme für den Marathon in der slowenischen Hauptstadt nämlich eindeutig eine weitere Aufwärtstendenz. Aus bescheidenen Anfängen ist man in der letzten Dekade jährlich im Schnitt um ungefähr einhundert Marathonis gewachsen.
Mit in diesem Jahr erstmals deutlich mehr als tausend Läufern auf der Königdistanz ist man inzwischen der mit Abstand teilnehmerstärkste Marathon zwischen der Linie München-Wien-Budapest auf der einen und Athen auf der anderen Seite. In Slowenien selbst gibt es ohnehin keine Laufveranstaltung, die dem Rennen in der Hauptstadt auch nur annähernd das Wasser reichen könnte.
Nicht nur die namensgebende lange Strecke ist allerdings dafür verantwortlich. Denn neben den zweiundvierzig Kilometern wird auch noch ein Halbmarathon angeboten, der - ein fast überall in der weltweiten Laufszene zu beobachtendes Bild - rund fünfmal so viele Teilnehmer anzieht. Und einen kaum kleineren "Recreational Run" über zehn Kilometer hat man auch noch im Programm, so dass am Sonntag des Marathons eine inzwischen fünfstellige Zahl von Menschen in Ljubljana die Schuhe schnüren.
In eine beinahe ähnliche Größenordnung stoßen allerdings am Vortag auch die Schülerläufe vor. Zwischen 4,2 Kilometer für die ältesten Jugendlichen und zweihundert Meter für die Drei- bis Fünfjährigen ist das Streckenangebot gestreut. Und sogar ein Lauf für noch jüngere Kinder, bei dem diese Distanz in Begleitung der Eltern zurück gelegt werden kann, gibt es. Auch der eine oder andere Kinderwagen rollt dabei noch über die Ziellinie.
"We run Ljubljana" lautet das Motto, mit dem man für die Veranstaltung wirbt. Auch die Slowenen setzen bei Reklame anscheinend längst auf englische Sprüche. Und tatsächlich scheint man die halbe Stadt in Bewegung gebracht zu haben. Zwei Tage lang ist damit die Innenstadt blockiert, der Verkehr deutlich eingeschränkt. Denn der Start- und Zielbereich könnte kaum zentraler liegen.
Schon der Name "Trg republike", also "Platz der Republik" hat einen gewissen Klang. Dass die Freifläche ansonsten als Parkplatz dient, ist zwar genauso ein Wermutstropfen wie das architektonisch nicht wirklich ansprechende Kaufhaus, das eine seiner Seiten einnimmt. Auch die zwar auffälligen, aber nicht unbedingt beeindruckenden Zwillingstürme auf der zweiten Kante passen in ihrem Baustil dazu.
Und das dahinter stehende Kongress- und Kulturzentrum "Cankarjev dom" nimmt man in ihrem Schatten kaum wahr. Doch ist das auf der anderen Seite des Platzes eben auch noch das sich ein wenig in einer Grünanlage versteckende "Narodni muzej Slovenije", das slowenische Nationalmuseum.
Vor allem aber steht daneben ein Gebäude, das man im ersten Moment als ganz normales Bürohaus einordnet. Erst der aufwendig gestaltete, rundherum mit Skulpturen verzierte Eingang macht ein wenig stutzig. In Wahrheit handelt sich dabei nämlich um den Sitz des slowenischen Parlaments. Sicherheitsmaßnahmen, Zäune, Barrikaden, Wachposten sucht man dennoch vergeblich.
Direkt vor dem Gebäude, nur wenige Schritte vom Portal entfernt werden sogar die Schüler auf ihre unterschiedlichen Distanzen geschickt, um nach der Umrundung einiger Straßenblocks den Platz der Republik aus der anderen Richtung wieder zu erreichen. In einem kleinen Ländchen ohne wirkliche weltpolitische Bedeutung und ernsthafte Konflikte geht es in dieser Hinsicht eben doch deutlich entspannter zu.
Der Lauf findet also nicht nur im Stadtkern, sondern sogar im Zentrum des ganzen Landes statt. Und das nicht nur, weil er praktisch direkt vor dem Sitz der gesetzgebenden Versammlung sein Ende findet. Vielmehr liegt auch Ljubljana selbst ziemlich genau in der Mitte Sloweniens, zwischen den Alpen, die den Nordwesten des Landes prägen, und der sich weiter nach Kroatien hinein ziehenden Karstlandschaft im Süden.
Weiter im Osten reicht zudem die Ungarische Tiefebene nach Slowenien hinein, in die das Hochgebirge über eine vorgelagerte Hügelzone langsam ausläuft. Und ganz im Westen hat das Land zwischen dem zu Italien gehörenden Triest und dem kroatischen Istrien auch einige Kilometer Anteil an der Adriaküste.
 |
 |
| Im früheren Kloster des Kreuzritterordens ist inzwischen ein Kulturzentrum eingezogen | Der Markt der Stadt verteilt sich über mehrere Plätze und Gassen |
Ljubljana selbst befindet sich in einer relativ flachen Übergangszone zwischen den Alpen und dem Karstgebirge. Doch während sich südlich und nördlich der Stadt Ebenen ausdehnen, reichen genau auf Höhe des Stadtkerns zwei Höhenzüge ziemlich dicht aneinander heran. Zwischen beiden windet sich das Flüsschen Ljubljanica hindurch, das seine Namensverwandtschaft nun wahrlich nicht verleugnen kann.
Nur einen Teil seines etwa achtzig Kilometer langen Weges trägt der Wasserlauf allerdings diesen Namen. Denn gleich mehrfach verschwindet er als typischer Karstfluss in Höhlen unter der Erde, um an anderer Stelle mit neuer Bezeichnung wieder an der Oberfläche aufzutauchen. Etwa ein Dutzend Kilometer nordöstlich des Zentrums, aber noch im administrativen Stadtgebiet Ljubljanas mündet der Fluss dann in die Save.
Natürlich kommt einer solchen Stelle eine ziemliche strategische Bedeutung zu. Insbesondere, da den eigentlichen Mittelgebirgszügen noch einmal zwei Hügel vorgelagert sind, die den Durchlass für die Ljubljanica auf kaum mehr als einen Kilometer verengen. In diesen Engpass zwängt sich die Altstadt der slowenischen Hauptstadt. In Norden und Süden breitet sich das bebaute Gebiet dann fächerförmig aus, so dass Ljubljana auf der Karte ein wenig an einen Schmetterling erinnert.
Obwohl die Kuppen im Westen der Innenstadt ein wenig höher sind, ist der Burgberg auf der Ostseite dennoch die eindeutig markanteste Erhebung. Ziemlich steil und abrupt erhebt er sich ungefähr achtzig Meter über den Stadtkern. Und zwischen der Ljubljanica, die ihn in einem engen Viertelbogen umfließt, und seinem Fuß passt an den engsten Stellen nur noch eine einzige Altstadtgasse.
Wie der Name unschwer vermuten lässt, wird die Kuppe des Hügels von einer Burg besetzt. In ihrem jetzigen Grundriss steht "Ljubljanski grad" dort seit dem fünfzehnten Jahrhundert. Doch bereits 1144 wird ein Vorläuferbau erstmals schriftlich erwähnt. Mehrfach erweitert und umgebaut bietet sie heute eine recht bunte Mischung unterschiedlicher Baustile. Der unverkennbare Turm wurde zum Beispiel erst im neunzehnten Jahrhundert ergänzt, in einer Zeit, in der die Burg längst als Gefängnis genutzt wurde.
Mehrere kurze, steile Pfade führen aus der Altstadt hinauf. Die deutlich flachere Straße, die von der Rückseite zum Parkplatz vor dem Burgtor führt, finden Touristen eher selten. Doch seit einigen Jahren überwindet eben auch eine Standseilbahn den Höhenunterschied. Und die kann sich selbst im ganz sicher nicht die Hauptsaison darstellenden Oktober über mangelnden Zuspruch nun wirklich nicht beklagen.
Berg und Burg dominieren jedenfalls das Stadtbild, sie dienen - weil fast immer irgendwo sichtbar - durchaus auch als gute Orientierungsmarke. Und zumindest eines der Wahrzeichen der Stadt ist Ljubljanski grad definitiv, vielleicht sogar das wichtigste. Da verwundert es wenig, dass die Befestigungsanlage auch im Logo des Marathons auftaucht. Hinter zwei Läufern im Vordergrund ist dort nämlich eindeutig ihre Silhouette auf dem Hügel zu erkennen.
Abgebildet ist sie praktisch genau aus jenem Blickwinkel, der sich vom Kongresni trg bietet, auf dem die Startnummern in einem großen Zelt ausgegeben werden. Neben mehreren Dutzend Kopien auf den Plakaten und Transparenten kann man also zudem gleich einmal - wenn auch aus der Distanz - das Original in Augenschein nehmen.
Obwohl nur wenige Meter vom Platz der Republik entfernt bietet der Kongressplatz ein völlig anderes Bild. Er ist nämlich nicht nur die größte sondern wohl auch die harmonischste Freifläche im Stadtkern Ljubljanas. Neben der barocken Ursulinenkirche und der aus dem späten neunzehnten Jahrhundert stammenden Philharmonische Akademie wird er ansonsten weitgehend von Gebäuden begrenzt, die errichtet wurden, nachdem im Jahr 1895 ein Erdbeben die Stadt schwer getroffen hatte. Am markantesten ist dabei ohne Zweifel die alte Universität.
Ab Donnerstag kann man sich bereits die Unterlagen abholen und ein wenig durch die Stände der Marathonmesse schlendern. Drei Tage lang bietet die Organisatoren zwischen neun Uhr am Morgen und sieben Uhr abends jeweils zehn Stunden Öffnungszeit. Doch auch am Sonntagmorgen sind die Schalter besetzt, was zumindest für die erst um 10:30 gestarteten beiden Hauptläufe Halb- und Vollmarathon also im Zweifelsfall von fast überall im kleinen Slowenien auch noch eine Anreise am Wettkampftag erlaubt.
So hält sich dann auch der Andrang an der Ausgabestelle selbst einen Tag vor dem Rennen in ziemlichen Grenzen. Lange Wartezeiten gibt es jedenfalls keine. Schon nach wenigen Minuten ist man mit einer durchaus reichhaltig gefüllten Tüte wieder auf dem Weg nach draußen. Neben den üblichen Probepäckchen und Werbezetteln steckt darin nämlich auch noch ein Langarm-Funktionshemd und eine Kopftuch mit dem Veranstaltungslogo. Und ein Gutschein für eine Portion Nudel auf der Pasta-Party am Samstagabend liegt ebenfalls noch bei.
 |
 |
 |
| Überall in der Stadt wird eifrig für den Marathon geworben | Unter den Hochhäusern am Platz der Republik befindet sich das Ziel | |
Im Ziel wird man neben der Medaille dann als Marathonläufer auch noch ein Trägerhemd überreicht bekommen. "Ich bin beim Ljubljana Marathon 42 Kilometer gelaufen" steht auf der Rückseite. Dass es von einem ganz anderen Sportartikelhersteller stammt als vom eigentliche Ausrüstungssponsor, muss man ja nicht allzu laut kundtun.
Stellt man all dem die Teilnahmegebühren gegenüber ergibt sich zumindest aus deutscher Sicht und für den Marathon ein wahrlich nicht schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn noch bis August ist man mit dreißig Euro dabei. Wer seine Meldung im September abgibt bezahlt auch nur fünfunddreißig Euro. Und mit einem eigenen Chip sind es sogar noch jeweils drei Euro weniger, also im günstigsten Fall gerade einmal siebenundzwanzig. Einzig die Nachmeldungen im Oktober sind dann mit siebzig Euro im Verhältnis richtig happig.
Umrechnen muss man dabei natürlich nicht. Denn schließlich ist Slowenien - hierzulande kaum wahrgenommen - nicht nur seit 2004 Mitglied der Europäischen Union, sondern hat auch bereits drei Jahre später den Euro als Zahlungsmittel eingeführt. Und zum sogenannten Schengenraum gehört die kleine slowenische Republik ebenfalls. Grenzkontrollen gibt es also bei der Einreise keine.
Als Unterscheidungskriterium zur Slowakei, mit der das Land so gerne verwechselt wird, kann jedoch keiner dieser Punkte dienen. Denn abgesehen von der Tatsache, dass die Slowaken ein wenig später auf die Gemeinschaftswährung umstellten, trifft eben alles auch auf sie zu. Dass man diese Sachverhalte über eigentlich so nahe gelegene Staaten überhaupt noch erwähnen muss, weil viele sie nicht kennen, ist allerdings peinlich genug.
Nicht nur das Zelt auf dem Kongressplatz erinnert die Bevölkerung Ljubljanas jedoch schon Tage vor dem Rennen an den Marathon. Großflächige Plakate sind an beleuchteten Reklamewänden aufgehängt, unzählige Fahnen mit dem Logo der Veranstaltung an Laternenmassen und Häusern verteilt und an einigen zentralen Stellen im Stadtkern auch Transparente über die Gassen der Fußgängerzone gespannt.
Unübersehbar legt die Stadt Ljubljana großen Wert darauf, den Lauf zu einem besonderen Ereignis zu machen und die eigene Bevölkerung entweder zum Zuschauen oder am Besten sogar zum Mitmachen zu bewegen. Neben einigen kulturellen Festivals taucht der "Ljublanski Maraton" auch als einziger Eintrag aus dem Sportbereich im Kalender der wichtigsten Veranstaltungen auf, der in den Tourismusprospekten abgedruckt ist.
Wirklich viele Besucher aus dem Ausland lockt der Lauf allerdings trotzdem nicht unbedingt an. In der Summe stammen weniger als zehn Prozent der Teilnehmer an den drei Wettbewerben der Erwachsenen nicht aus Slowenien. Beim Zehner bleiben die Einheimischen - nicht unbedingt überraschend - sogar fast vollständig unter sich. Auch der Halbmarathon mit nicht einmal fünfhundert von fast exakt sechstausend Zieleinläufen zeigt kein wirklich anderes Bild.
 |
 |
 |
| Zwischen Gornji trg, dem Oberen Platz (links) und Mestni trg, dem Stadtplatz mit dem Rathaus (rechts) mit seinem prunkvollen Innenhof erstreckt sich die kleine, aber feine Altstadt | ||
Am höchsten ist der internationale Anteil noch beim Marathon, wo immerhin knapp dreihundert Starter - und damit fast ein Viertel der antretenden Läufer - keinen slowenischen Pass haben. Und selbstverständlich ist die Verteilung dabei auch etwas breiter gestreut. Denn mehr als zwei Dutzend Nationen sind in der Liste verzeichnet.
Das stärkste Kontingent stellt sowohl beim Voll- wie auch beim Halbmarathon - nicht nur auf Slowenisch sondern auch in anderen slawischen Sprachen "Polmaraton" genannt - das Nachbarland Kroatien. Zwei weitere Nachbarn, nämlich Italien und Österreich folgen auf den nächsten Plätzen. Auch in dieser Hinsicht bleibt der Lauf in Ljubljana dann doch eher eine regionale Veranstaltung.
Ohnehin hört man in der Stadt durchaus häufiger einmal italienische Sprachfetzen. Ein nicht unbedingt kleiner Teil der ausländischen Touristen scheint aus dem nahen Italien zu stammen. Doch fast noch häufiger kommt einem Deutsch zu Ohren. Dessen Tonfall lässt allerdings in der Mehrzahl der Fälle vermuten, dass die Sprecher nicht allzu weit nördlich der slowenischen Grenze zu Hause sind.
Die Verbindungen zu Österreich sind nicht nur wegen der geringen Entfernung relativ eng. Vielmehr gehörte Slowenien viele Jahrhunderte lang zum Habsburgerreich. Rund die Hälfte des heutigen Staates bestand aus dem Herzogtum Krain. Andere Gebiete im Nordosten waren Bestandteile der Kronländer Kärnten und Steiermark. Und das heutige Ljubljana war unter dem deutschen Namen Laibach bekannt. Eine Bezeichnung, die in Österreich noch immer gebräuchlich ist, aber bei weitem nicht von allen Slowenen gerne gehört wird.
Erst nach dem ersten Weltkrieg und dem damit verbundenen Zerfall der Donaumonarchie wurde die Region ins neu entstandene "Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen" eingegliedert. Später wurde daraus dann ein Staat namens "Jugoslawien" - was übersetzt nichts anderes als "Südslawien" bedeutet.
Auch nördlich der neu entstandenen Grenze gab und gibt es - insbesondere in Kärnten - allerdings noch einen slowenischen Bevölkerungsanteil. Dieser kommt gelegentlich auch in die Schlagzeilen, wenn es zum Beispiel wieder einmal um das regelmäßig hoch kochende Problem zweisprachiger Beschilderung der Ortschaften geht. Und rund um das nach dem ersten Weltkrieg Italien zugeschlagene Triest leben es ebenfalls noch etliche tausend Slowenen.
Doch eigentlich ist das slowenische Siedlungsgebiet abgesehen von den eigentlich üblichen leichten Überlappungen in den Randzonen ziemlich klar abzugrenzen. Das Gebiet ist bezüglich der ethnischen Zusammensetzung ziemlich homogen, was einen großen, einen wirklich entscheidenden Unterschied zum Rest des früheren Jugoslawiens darstellt.
So folgte der nach einer eindeutig ausgegangen Volksabstimmung im Jahr 1991 von Slowenien einseitig erklärten Unabhängigkeit dann auch kein monate- oder gar jahrelanger Krieg wie später in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Relativ schnell ging die Loslösung über die Bühne. Nicht einmal ein Jahr danach hatte das junge Land nicht nur eine neue demokratische Verfassung sondern war auch schon Mitglied der Vereinten Nationen.
Schnell hatte man dem - ähnlich wie beim Zerfall eines Atomkernes - noch immer in weitere kleinere Einzelstücke auseinander brechenden einstigen Jugoslawien den Rücken gekehrt und sich Mitteleuropa zugewandt. Und von all diesen inzwischen auf über ein halbes Dutzend angewachsenen Spaltprodukten ist Slowenien vermutlich das mit Abstand stabilste und - um im Bild zu bleiben - strahlentechnisch am wenigsten gefährliche.
Ganz unblutig verlief die Trennung zwar nicht. Bei den zehn Tage andauernden Gefechten nach dem Einmarsch der jugoslawischen Volksarmee, der direkt auf die Ausrufung des eigenen Staates folgte, kamen immerhin mehrere Dutzend Menschen ums Leben. Aber verglichen mit den Hundertausenden von Opfern, die in den Folgejahren die Kämpfe in Kroatien und Bosnien forderten, erscheinen die Geschehnisse dennoch beinahe friedlich.
Um Slowenien ist es in der Zeit seit der Unabhängigkeit ziemlich ruhig geworden. Nachrichten produzierten die anderen. Und vielleicht ist das gar nicht einmal das schlechteste Zeichen. Ljubljana und seinen Einwohnern ist es dann auch sicher lieber, nicht jedem sofort geläufig zu sein, als wie zum Beispiel das bosnische Srebrenica einen bekannten Namen zu haben, der sich auf eine ziemlich unrühmliche Geschichte begründet.
 |
 |
 |
| Die Usulinenkirche (links), das Opernhaus (mitte) und das frühere Hauptpostamt liegen im kompakten Zentrum der Stadt jeweils nur wenige Gehminuten voneinander entfernt | ||
Da kann man von slowenischer Seite vielleicht sogar akzeptieren, immer wieder einmal mit der Slowakei verwechselt zu werden. Das im ersten Moment auch missverständliche Länderkürzel "SLO" ist allerdings eindeutig Slowenien zugeordnet, während Slowaken an einem "SK" auf dem Auto oder im Sport an einem "SVK" hinter dem Namen zu erkennen sind.
Gut zwei Hände voll solcher Einträge findet man auch in der Ergebnisliste des Marathons, eine weitere Hand voll auf der Halbdistanz, womit die kleine Slowakei praktisch genauso viele Teilnehmer wie das doch wesentlich größere Deutschland stellt. Angesichts von gerade einmal zwölf Voll- und dreizehn Halbmarathonis sowie drei Teilnehmern beim Lauf über zehn Kilometer, lässt sich eigentlich nur folgern, dass nicht nur das Land Slowenien und die Stadt Ljubljana sondern auch diese Veranstaltung weitgehend übersehen wird.
Die Zahl der Briten ist dagegen beinahe dreimal so hoch, was allerdings wohl auch der Tatsache geschuldet ist, dass eine Billigfluggesellschaft Ljubljana von London aus direkt anfliegt. Ansonsten wird der kleine Flughafen, auf dem es doch eher geruhsam zugeht und der sowohl von außen wie auch von innen eher wie ein mittelgroßer Bahnhof wirkt, hauptsächlich von der einheimischen Linie Adria Airways bedient. Aus dem deutschsprachigen Raum bietet sie immerhin Verbindungen von Frankfurt, München, Zürich und Wien.
Aus einer anderen Region sind allerdings Sportler angereist, deren Wahl nicht unbedingt von günstigen Flügen beeinflusst wurde. Denn mehr als ein Dutzend Laufprofis aus Ostafrika hat man in Ljubljana verpflichtet. Auch in dieser Hinsicht gibt man sich also größte Mühe, den Marathon zu einem international zumindest ein wenig mehr beachteten Ereignis aufzubauen.
Zwar können sich die Slowenen nicht die absoluten Asse der Laufszene leisten, doch völlig unbekannt sind einige der Athleten eben auch nicht. Evans Ruto aus Kenia war zum Beispiel mit 2:10:17 nicht nur der Vorjahressieger in der slowenischen Hauptstadt, im Jahr zuvor stellte er in Köln auch den noch immer gültigen Streckenrekord von 2:08:36 auf. Auch sein Landsmann Daniel Too steht schon in den Siegerlisten von Köln und hat zudem eine Bestzeit von 2:08:29.
Und Kiprotich Kenei lief 2007 in Hamburg sogar eine 2:07:42 und dazu noch einige weitere Male unter 2:10. Alemayehu Shumye als kleines äthiopisches Gegengewicht zur kenianischen Übermacht hat aus dem Jahr 2009 eine in Frankfurt gelaufene 2:08:46 stehen und erreichte im Frühjahr in Rotterdam 2:09:36. Die beste Vorleistung kann allerdings der Kenianer Daniel Rono vorzeigen, der 2008 als Zweiter beim Rotterdam Marathon eine 2:06:58 erzielte. Es ist eine Aufzählung, die ziemlich exemplarisch das große Dilemma der afrikanischen Läufer zeigt.
Denn alle Genannten sind absolute Weltklasseathleten, ausgestattet mit Bestleitungen, die schneller als der noch immer von Jörg Peter gehaltene, aus dem Jahr 1988 datierende deutsche Rekord von 2:08:47 sind. Und doch kennt sie abgesehen von einigen Managern und Veranstaltern praktisch niemand.
 |
 |
| Nach einem schweren Erdbeben im Jahr 1895 wurde Ljubljana mit meist dreistöckigen Stadtpalästen wieder aufgebaut | |
Zu groß ist das Reservoir an Spitzenläufern. Hunderte von Kenianern und zumindest Dutzende von Äthiopiern tummeln sich in den oberen Rängen der Weltrangliste. Nur selten tauchen dazwischen einmal Europäer, Amerikaner oder Asiaten auf. Selbst die Zeit von Daniel Rono, mit der er vor einem guten Jahrzehnt noch am Weltrekord gekratzt hätte, ist längst nichts anderes mehr als Dutzendware. Bereits mehr als dreißigmal wurde dieses Ergebnis alleine im Jahr 2011 unterboten.
Namen und Gesichter sind - so hart es sich auch anhört - für einen unbeteiligten Beobachter in der Regel vollkommen austauschbar. Und bei der schnellen Frequenz, in der neue Talente aus dem ostafrikanischen Hochland in die Eliteliga vorstoßen, haben selbst die wirklich Interessierten kaum noch eine echte Chance, den Überblick zu behalten.
Die Afrikaner kommen zu den jeweiligen Marathons, liefern meist ohne viel Federlesen die im internationalen Wettbewerb um mediale Aufmerksamkeit von den Veranstaltern gewünschten Klassezeiten ab, erhalten dafür Preisgelder, die oft nicht einmal dem Wochenhonorar eines externen Firmenberaters hierzulande entsprechen, und sind wenig später auch schon wieder vergessen. Das ist in Slowenien nicht anders als hierzulande auch.
Als Kontrast präsentiert sich das Wetter zum Ljublanski Maraton dagegen nicht unbedingt afrikanisch. Denn gerade einmal sechs bis acht Grad betragen die Temperaturen über das gesamte Wochenende. Und nur in ganz seltenen Augenblicken, in denen sich die niedrig hängenden Wolken ein wenig lichten, lassen sich die eigentlich doch so nahen Alpen zumindest von einigen Aussichtspunkten auf dem Burgberg erahnen.
Trotz des ziemlich herbstlichen Wetter haben dennoch immer wieder Leute in den unzähligen Straßencafés, die sich in der kleinen Fußgängerzone und an beiden Ufer des Ljubljanica, entdecken lassen, Platz genommen. Einige Wirte habe sogar Decken auf den Stühlen bereit gelegt. Denn natürlich ist das Sitzen im Freien nicht nur darauf zurück zu führen, dass Slowenen Frischluftfanatiker wären. Auch das wie in den meisten anderen Ländern geltende Rauchverbot spielt dabei eine wichtige Rolle.
Trotzdem kann man sich durchaus vorstellen, welch ein Leben dort an einem sonnigen Frühlingstag herrschen dürfte. Gerade wegen der schon aufgrund der geographischen Gegebenheiten geringen Ausmaßes des eigentlichen Zentrums strahlt die Stadt aber dennoch eine gewisse Gemütlichkeit aus.
Die Hektik einer wirklichen Metropole kann im nicht von breiten Boulevards sondern schmalen Gassen geprägten und ziemlich überschaubaren Kern nicht aufkommen. Obwohl das mit Abstand größte Ballungszentrum des Landes verbreitet Ljubljana dennoch - und zwar im positivsten Sinne - einen eher kleinstädtischen Charme.
Aus dem früheren österreichische Provinzstädtchen und der späteren jugoslawischen Provinzstadt ist schließlich erst vor gerade einmal zwei Jahrzehnten die Hauptstadt eines unabhängigen Staates geworden. Der manchmal angestellte Vergleich mit Prag stellt sich deshalb vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert dar. Schon aufgrund der ungefähr gleichen Größe und durchaus ein wenig ähnlichen Topographie wäre Salzburg wohl doch ein deutlich besser geeigneter Maßstab.
Auch die Marathons dieser beiden Städte haben einige Gemeinsamkeiten. Einen Zwei-Runden-Kurs etwa, der zwar im Zentrum startet und endet, aufgrund mangelnder Ausdehnung des zwischen zwei Bergen eingekeilten Stadtkerns dann aber hauptsächlich durch die Außenbezirke führt. Und selbst für einen Zehn-Kilometer-Lauf ist Ljubljanas Altstadt - auf Slowenisch "Staro mestno jêdro" - eigentlich fast schon zu klein. Zumindest wenn man berücksichtigt dass dieses Starterfeld alleine etwa fünftausend Köpfe umfasst.
Die Läufer der kürzeren Distanz absolvieren die Hälfte ihres Rennens auf dem ersten Teil des Marathonkurses und steuern dann auf fast direktem Weg wieder das Ziel am Trg republike an. Allerdings starten sie nicht gemeinsam mit den anderen beiden Distanzen. Schon zwei Stunden vorher werden sie um 8:30 auf die Strecke geschickt.
Zumindest die Schnellsten unter ihnen sind also längst fertig, als die Voll- und Ganzmarathonis erst langsam anfangen, sich im Start- und Zielbereich einzufinden. Mitja Krevs hat dabei mit 31:15 einen deutlichen Vorsprung vor Blaž Grad (33:25) und Rok Potocnik (33:44). Bei den Frauen liegt nach 39:37 Mojca Grandovec vorne. Auf den Plätzen folgen Tina Cacilo in 40:22 und Anja Bajcar in 40:53.
 |
 |
| Noch warten die Zielaufbauten auf … | ... die vielen Kinder und Jugendlichen, die bereits am Samstag auf die Strecke geschickt werden |
Selbst wenn diese Zeiten an der Spitze nicht von völlig Untrainierten erbracht werden, trägt der "Rekreativni tek" seine ungefähr als "Hobbylauf" zu übersetzende Bezeichnung nicht zu Unrecht. Denn nur ungefähr ein Achtel aller Teilnehmer legt dabei den Kilometer in einem Schnitt von unter fünf Minuten zurück. Fast die Hälfte braucht gar länger als eine Stunde. Und für einen Platz auf dem Treppchen muss man sowohl beim halben als auch beim ganzen Marathon ein höheres Tempo laufen als auf der kürzesten angebotenen Strecke.
Ein wenig eng wird es durch die nahezu gleichzeitige Ankunft der Zehner nach und der Marathonläufer vor ihrem Rennen in der Schule, die man als Ort für Umkleide und Kleideraufbewahrung ausgesucht hat. Nur von einer kleinen Grünanlage vom Platz der Republik getrennt bietet diese zwar kurze Wege, doch bei weiterem Wachstum der Veranstaltung käme man wohl schnell an die logistischen Grenzen.
Während die Kurzstreckler ihre Taschen direkt im Schulgebäude abgeben und abholen, hat man für die Läufer der längeren Distanzen ein Zelt in den Hof gestellt. Doch ist dieser eben nicht gerade weiträumig, so dass der Platz für so viele durcheinander wuselnde Menschen nicht wirklich ausreicht. Das zweite, als Kabine gedachte Zelt ist natürlich ebenfalls nicht wirklich geräumig, wenn die einen nach bereits absolviertem Lauf ihre Wechselbekleidung überziehen, während die anderen gerade erst ihr Wettkampfdress anlegen.
Ein wenig schwer machen sich die Organisatoren die Sache zusätzlich, da weder schon beschriftete Kleiderbeutel noch vorbereitete Anhänger mit den Startunterlagen ausgegeben werden. So müssen die Helfer erst einmal jede einzelne Nummer auf die Plastiktüte schreiben, in der dann Rucksack oder Sportasche verschwinden. Erst dann kann diese von den durchaus eifrigen Freiwilligen an der entsprechenden Position abgelegt werden. Der Andrang wäre sicher durch eine schnellere Abfertigung zu verringern.
Und eventuell könnte man sich auch die Wachleute einer Sicherheitsfirma sparen, die den Zugang zum mit Gittern abgesperrten Bereich vor der Taschenaufbewahrung kontrollieren. Erst wenn dort wieder Platz genug ist, wird der nächste Schub der sich vor ihnen stauenden Läufer durchgelassen. Eine für eine Laufveranstaltung doch ziemlich ungewöhnliche und überraschende Maßnahme.
Gestartet wird nicht wie bei den Kinder- und Jugendläufen auf der Straße vor dem Parlament sondern einige Schritte entfernt auf der zu ihr im rechten Winkel angeordneten "Slovenska cesta". Die ziemlich genau in Nord-Süd-Richtung verlaufende "slowenische Straße" ist die Mittel- und Hauptverkehrsachse des Zentrums von Ljubljana.
Vom Burgberg im Osten und dem "Tivoli" genannten Park am Fuß von Rožnik- und Šišenski-Hügel auf der Westseite ist sie etwa gleich weit entfernt. Und außerdem teilt die Straße Ljubljana zumindest grob in die eigentliche, eng bebaute Altstadt mit aneinander klebenden Häuserreihen und barocken Kirchen sowie den deutlich großzügiger angelegten neueren Teil, in dem sich die meisten Repräsentativbauten wie Nationalmuseum, Nationalgalerie oder Opernhaus befinden.
 |
 |
| Auf unterschiedlich langen Runden laufen die Schüler in großen Pulks mitten durchs Stadtzentrum | |
Obwohl die Slovenska cesta ganz eindeutig die breiteste Straße im Stadtkern ist, hat sie im Startbereich nicht mehr als vier Fahrspuren. Und so zieht sich die Aufstellungszone vom Kongressplatz, neben dem sich die Eliteläufer in den ersten Reihen einordnen, gleich über mehrere Straßenblocks nach hinten.
Auch zeitlich gestaffelte Startgruppen hat man markiert. Allerdings ist von Seiten der Veranstalter weder eine Einsortierung aufgrund einer bei der Anmeldung anzugebenden Vorleistung durchgeführt noch gibt es Zugangskontrollen. Also kann sich jeder seine Startposition nach eigenem Gutdünken selbst auswählen.
Laute Musik dröhnt aus den Boxen. Die Ansagen dazwischen erfolgen weitgehend in Slowenisch. Wer im Osten Deutschlands aufgewachsen ist und dort in der Schule mit Russisch in Kontakt gekommen ist, hat - selbst wenn beide Sprachen nicht allzu eng miteinander verwandt sind - vielleicht eine kleine Chance zu erahnen, um was es da gehen könnte. Wer dagegen nur Sprachen aus der germanischen und der romanischen Gruppe näher kennen gelernt hat, versteht praktisch nichts. Einfach zu unterschiedlich sind Vokabular und Grammatik.
Abschrecken von einem Besuch in Slowenien sollte das allerdings niemanden. Denn wie auch in andere kleine Nationen, die nicht damit rechnen können, dass man ihre Landessprache versteht, sind die Slowenen durchaus mit Fremdsprachen vertraut. Insbesondere die Jüngeren sprechen oft ein recht gutes Englisch. Deutsch- und Italienischkenntnisse sind insbesondere in den für Touristen interessanten Bereichen ebenfalls nicht gerade selten.
Und ausländischen Besuchern bietet man noch zusätzlichen Service. Die Beschilderungen an Restaurants und Geschäften sind zum Beispiel neben Slowenisch meist auch gleich in Englisch angebracht. Und manches ist zudem daneben noch in Deutsch und Italienisch zu lesen. Selbst die Fahrpläne der Buslinien sind praktisch immer zweisprachig ausgehängt.
Da es keine Straßen- schon gar keine U-Bahn in Ljubljana gibt, sind Busse mehr oder weniger das einzige öffentliche Verkehrsmittel im Stadtgebiet. Doch abgesehen vom Transfer vom und zum Flughafen muss man sich eigentlich gar nicht weiter mit ihnen beschäftigen. Denn den kompakten und selbst bei großzügigster Abgrenzung kaum mehr als zwei bis drei Quadratkilometer umfassenden Stadtkern kann man ohne Probleme und eigentlich sogar besser zu Fuß erkunden.
"Tri, dve, ena" erschallt es aus dem Lautsprecher. Zumindest beim Herunterzählen der letzten Sekunden, lässt sich dann doch nicht verheimlichen, dass auch das Slowenische wie alle slawischen Sprachen zur großen indoeuropäischen Familie zählt. Man braucht schließlich nicht viel Phantasie, um zu erkennen, welche Zahlen da gemeint sind.
 |
 |
| Der Marathonkurs bleibt nach dem Start nur kurz in der Innenstadt, … | … schon nach wenigen Kilometern führt er sogar eine Zeit lang durch den Wald |
Doch während sich die Spitzengruppe anschließend sofort in Bewegung setzt, passiert in den hinteren Reihen erst einmal gar nichts. Ein Wellenstart sorgt nämlich dafür, dass nicht alle gleichzeitig auf die Strecke gehen. Erst nach mehreren Minuten sind auch die Blocks am Ende des Feldes langsam nach vorne aufgerückt und können loslaufen.
Während dieser Wartezeit hämmern aus den Boxen immer weiter ziemlich wilde Trommelrhythmen, die sich beim Passieren der Startlinie keineswegs als Konserve herausstellen. Denn auf einer Stahlrohrbühne gegenüber dem Startbogen bearbeitet fast ein Dutzend Musiker einer hauptsächlich aus Schlaginstrumenten zusammengesetzten Band ihre Gerätschaften. Der einsame Posaunist, der das Ganze mit ein bisschen Melodie unterlegen soll, dringt gegen die Lautstärke seiner die Stöcke schwingenden Kameraden jedenfalls kaum durch.
Doch schnell wird es ruhiger. Schon nach wenigen hundert Metern biegt der anfänglich nach Süden führende Kurs in westliche Richtung ab. Von den anfangs ziemlich dicht stehenden Zuschauern, von denen einige zur besseren Sicht sogar auf die Fenstersimse der umstehenden Häuser geklettert sind, ist auf der - zumindest für Ljubljana - relativ breiten Ausfallstraße bald nicht mehr viel zu sehen.
Nur ein paar Meter entfernt, hinter den Universitätsgebäuden, die anfangs die Straße säumen, sind Reste der Stadtmauer erhalten, von der die römische Kolonie Emona umgeben war, die sich genau dort befand, wo sich heute der Stadtkern Ljubljanas zwischen die beiden Hügel hinein zwängt. Denn selbstverständlich hatten auch die Römer schon die strategische Bedeutung dieses Ortes erkannt. Bei Bauarbeiten kommen deshalb - wie bei auf römische Gründung zurück gehenden deutschen Städten auch - immer wieder einmal antike Funde zum Vorschein.
 |
 |
| Nach acht Kilometern | Eigentlich führt die offizielle Strecke auf der Straße entlang, die Mehrzahl der Läufer wählt dennoch die mit weniger Höhemeter versehene Abkürzung auf dem Radweg |
Wirklich durchgängig ist die Stadtgeschichte Ljubljanas allerdings nicht. Denn in der Völkerwanderungszeit wurde das von den Hunnen geplünderte und zerstörte Emona von den verbliebenen Einwohnern vermutlich irgendwann endgültig aufgegeben. Erst im zwölften Jahrhundert wird in schriftlichen Dokumenten dann wieder eine Siedlung an dieser Stelle erwähnt. Selbst wenn die Gegend vermutlich nicht völlig unbevölkert war, gibt es über die Zeit dazwischen praktisch keine Informationen.
Nur gut einhundert Jahre später kam die in jener Zeit nahezu ausschließlich unter ihrem deutschen Namen "Laibach" bekannte Stadt mitsamt dem umliegenden Territorium der Markgrafschaft Krain dann unter habsburgische Oberhoheit. Und abgesehen von einer kurzen Episode, in der Ljubljana als "Laybach" Hauptstadt der von Kaiser Napoleon von Frankreich annektierten "Illyrische Provinzen" war blieb sie das auch bis 1918.
Selbst während der größten Ausdehnung des Osmanischen Reiches war die Region im Gegensatz zu allen anderen südslawischen Gebieten nicht unter türkische Herrschaft. So sehen sich die Slowenen dann meist auch ganz klar zu Mitteleuropa gehörend und nicht etwa als integraler Bestandteil der Balkanhalbinsel.
Ein ziemlicher Kontrast zur Einstellung hierzulande, wo etliche noch immer ihre Probleme damit haben, die Zerfallsprodukte des nicht mehr existenten Staates, den man einst eben nur als Ganzes in der Schule kennen gelernt hat, richtig einzuordnen. Egal ob Slowene, Kroate, Serbe oder Mazedonier, auch zwanzig Jahre nach dem Auseinanderbrechen sind und bleiben sie in den Augen ziemlich vieler einfach alle nur "Jugoslawen".
Der Publikumszuspruch hat wieder deutlich zugenommen, als man nach knapp zwei Kilometern in eine deutlich schmalere Seitenstraße abbiegt. Doch steht an der Ecke ja auch eine Blaskapelle, die durchaus schmissige Melodien zum Besten gibt. Rund ein halbes Dutzend weiterer Musikgruppen wird man Verlauf des Rennens noch begegnen. Auch in dieser Hinsicht ist man in Ljubljana eindeutig bemüht wie einige Stadtteilfeste am Streckenrand zeigen.
Legt man die nicht unbedingt üppige Einwohnerzahl der Stadt zu Grunde ist das Zuschauerinteresse durchaus im Rahmen des bei Marathons dieser Größenordnung absolut üblichen. Ein durchgängiges Spalier kann man unter diesen Voraussetzungen eigentlich kaum erwarten. Bei realistischer Einschätzung - also ohne das leider zur Gewohnheit gewordene Spiel der Veranstalter mitzumachen, bei dem die Angaben manchmal sogar um den Faktor zehn zu hoch geraten - sind es wohl sicher einige Tausend.
Das ist angesichts der äußeren Bedingungen wahrlich kein schlechter Wert. War es am Vortag zwar trüb aber immerhin trocken, fällt der Marathonsonntag nämlich noch ein wenig schmuddeliger aus. Die Straße ist nass, selbst wenn es nicht mehr wirklich regnet. Im Verlauf des Rennens wird es auch später nur gelegentlich etwas nieseln. Doch einen goldenen Oktobertag haben die Macher des Ljublanski Maraton nun wahrlich nicht ausgesucht. Das Wetter erinnert viel eher an den ungemütlichen November.
 |
 |
 |
| Ein modernes Büroviertel passsieren die Marathonis auf ihrem Weg zurück in die Innenstadt | ||
Die Straße führt auf eine Unterführung zu. Nicht wirklich hoch über ihr scheint die Bahnstrecke zu verlaufen. Also wartet man irgendwie darauf, dass sich der Asphalt ein wenig absenkt. Doch das tut er nicht. Ein Verkehrsschild warnt vielmehr davor, dass die Brücke gerade einmal 2,30m hoch sei. Schon Normalwüchsige könnten also beinahe die Decke erreichen, wenn sie die Arme heben. Und wenn sich ein hochgewachsener Basketballer am Lauf beteiligen würde, dürfte es für ihn in der Flugphase tatsächlich ganz schön eng werden.
Gerade einmal zwei Kilometer sind absolviert, doch hinter der Unterführung wähnt man sich schon nicht mehr in einer Großstadt. Die meist an einen Garten grenzenden kleinen Häuser könnten genauso gut in einer beliebigen slowenischen Ortschaft irgendwo auf dem Land stehen. Einen Kilometer später läuft man sogar ein kurzes Stück über offenes Gelände, das sich zwischen zwei Stadtteilen erstreckt.
Nach einem kurzen Schlenker durch ein nagelneues Gewerbegebiet, dessen Bürogebäude noch nicht einmal bezogen sind, lässt man die Stadt endgültig hinter sich. Die Markierung für Kilometer fünf - jeder einzelne ist mit einer großen Tafel, die man schon aus großer Entfernung erkennen kann, ganz exakt gekennzeichnet - befindet sich bereits mitten im Wald. Das dritte Achtel der Runde hat dann auch wesentlich mehr von einem Landschaftslauf als von einem Stadtmarathon.
Erst mit Kilometer sieben tauchen wieder erste Häuser auf. Ohne es wirklich zu merken, weil der Wald die Sicht versperrte, hat man einen großen Bogen um Rožnik- und Šišenski-Hügel geschlagen und ist nun im Nordwesten Ljubljanas gelandet. Denn zwischen diesen beiden und dem eigentlichen Mittelgebirge gibt es noch einmal eine Senke, die kaum höher liegt als das Stadtzentrum.
Den höchsten Punkt des Marathonkurses hat man dabei gerade schon passiert. Doch liegt dieser eben keine zwanzig Meter über der niedrigsten Stelle der einundzwanzig Kilometer langen Schleife. Nicht viel mehr als eine kleine Welle stellt er dann auch dar. Zumindest auf der ersten Runde mit frischen Beinen registriert man sie kaum. Ansonsten stören nur noch einige Brücken und Unterführungen den Laufrhythmus auf einer weitgehend ebenen Strecke.
Die Straße, die man gerade belaufen hat, ist die einzige, die durch das mehrere Quadratkilometer große Forstgebiet im Westen Ljubljanas schneidet. Die weitgehend naturbelassenen Hügel schließen direkt an den angelegten Tivolipark an, der seinerseits nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt ist. Es dürfte wohl nur wenige Hauptstädte geben, in denen man nur einen einzigen Kilometer laufen muss, um von der belebten Innenstadt einsame Waldpfade zu erreichen.
 |
 |
| Durch den Winkel der Spiegelglasfenster kann man sich problemlos selbst beim Laufen zusehen | |
Grob gesprochen hat der Marathonkurs von Ljubljana das Aussehen einer das V-Zeichen formenden Hand. Die Handwurzel und die Außenseite mit den beiden eingeklappten Fingern hat man im Süden und Westen bisher umlaufen. Nun folgen die beiden ausgestreckten und leicht gespreizten Mittel- und Zeigefinger als ziemlich schmale aber lang gezogene Ausbuchtungen nach Nordwesten und Norden.
Der erste beginnt mit einem Linksschwenk an einer Kirche. Aufgrund der Vergangenheit Sloweniens im Habsburgerreich sind seine Einwohner größtenteils katholisch. Doch obwohl heute nur ungefähr ein Prozent der Slowenen sich als Protestanten bezeichnen, hat die Reformation eine ziemliche Bedeutung für das Land und seine nationale Identität. Denn ähnlich wie in Deutschland, wo die Bibelübersetzung Luthers großen Einfluss auf die Sprachentwicklung hatte, gibt es auch in Slowenien einen ähnlich wichtigen Text.
Der Katechismus von Primož Trubar gilt sogar als das erste Buch, das überhaupt in slowenischer Sprache verfasst wurde. Geschrieben wurde es allerdings in Tübingen. Trubar, der begann im Dom von Ljubljana Messen auf Slowenisch zu halten und sich dabei immer mehr den Ideen der Reformation annäherte, war nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits exkommuniziert und aus seiner Heimat vertrieben worden.
Repressionsmaßnahmen in den folgenden Jahrzehnten sorgten dafür, dass die anfänglich insbesondere in den Städten vorhandene Begeisterung der Slowenen für den Protestantismus schnell wieder verflog. Nicht nur Trubar wurde zur Emigration gezwungen, im Zuge der von den Habsburgerkaisern forcierten Gegenreformation musste jeder der sich nicht zum Katholizismus bekannte, das Land verlassen. Wie wichtig Primož Trubar für Slowenien allerdings trotzdem ist, zeigt die Tastsache, dass sein Konterfei die slowenische Ein-Euro-Münze ziert.
Eine weitere Musikkapelle bemüht am Streckenrand eifrig ihre Blasinstrumente. Und es ist beinahe selbstverständlich, dass an dieser Stelle wieder deutlich mehr Zuschauer stehen. Schräg gegenüber ist ein großes "Šola" auf der Straße zu lesen. Mit ein wenig Überlegen lässt sich darin durchaus die Warnung an Autofahrer erkennen, vor der "Schule", die man gerade passiert langsam zu fahren. Ganz so unverständlich ist das Slowenische bei allen Unterschieden manchmal dann eben doch nicht.
Insbesondere Lehnwörter sind zumindest vom Wortstamm her gelegentlich recht ähnlich. Dass sich hinter der slowenischen "Opera" die "Oper" verbirgt, ist sowieso klar. Ähnliches gilt für die "Galerija", das "Muzej" oder die "Katedrala" natürlich genauso. Und nach kurzem Aufenthalt kann man auch erahnen, dass es in Gebäuden mit dem Schriftzug "Restavracija" etwas zu essen gibt, selbst wenn man ohne vorheriges Üben besser nicht versuchen sollte das Wort auszusprechen.
Die wichtigsten Redewendungen, mit denen wie üblich auch ohne echte Sprachkenntnisse schon einmal eine positive Grundeinstellung beim einheimischen Gegenüber erzeugt werden kann, weil man sich zumindest bemüht, sind dagegen nicht ganz so schwer und auch schnell identifiziert. "Dober dan" steht für "guten Tag". Und mit "hvala" bedankt man sich. Anderes was sich auf der Straße aufschnappen lässt, ist dann nicht unbedingt slowenischen Ursprungs, dafür aber umso leichter zu übernehmen. Das "pardon" zum Beispiel, mit dem man um Entschuldigung bittet.
Und auch, wenn man dem geschrieben "cao" vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt ansieht, was sich dahinter verbergen könnte, lässt sich in den entsprechenden Situationen ausgesprochen das italienische "ciao" eindeutig erkennen. Genauso verhält es sich auch mit den vom Publikum am Rande der Marathonstrecke immer wieder zu hörenden Zurufen "bravo" und "super", die auch Nichtslowenen neuen Schwung geben können.
Dass sich der eine oder andere fremde Begriff eingeschlichen hat, ist nicht wirklich überraschend. Schließlich bildet das Slowenische den äußersten nordwestlichsten Eckpunkt im Verbreitungsgebiet der südslawischen Sprachen. Im Dreiländereck mit Italien und Österreich treffen germanischer, romanischer und slawischer Sprachraum - also die drei in Europa wichtigsten Gruppen - direkt aufeinander. Und im Osten grenzt mit dem Ungarischen sogar noch eine weitere völlig andere, von der Herkunft nicht einmal indoeuropäische Sprache an.
Eine Brücke führt über die Ringautobahn, die Ljubljana umgibt. Jenseits der Schnellstraße wird das durchlaufene Umfeld ein wenig industrieller. Kleinere Lager- und Werkshallen tauchen immer öfter einmal inmitten der Wohnbebauung auf. Einige Freiflächen breiten sich ebenfalls zwischen den Häusern aus. Bei Stadtplanern dürfte so ein Stadtviertel wohl in die Kategorie "Mischgebiet" einsortiert werden.
Dennoch ist durchaus Leben an der Strecke. Durch ein regelrechtes Spalier von Fahnen läuft man sogar, denn eine Gruppe hat zwei Dutzend Nationalflaggen organisiert und schwenkt sie nun hin und her. Einige davon sind ziemlich exotisch. Unter anderem hat man Kanada, Südafrika und Brasilien dabei. Auch die Kenianer in der Spitzegruppe können sich über Anfeuerung mit ihrer eigenen Fahne freuen. Der britische Union Jack sowie die französische Trikolore finden sich ebenfalls.
 |
 |
 |
| Marathonsieger Daniel Too läuft mit 2:08:25 einen neuen Streckenrekord | Auch Joseph Lagat als Zweiter in 2:08:50 und … | … Michael Chege als Dritter in 2:09:12 bleiben noch unter der alten Bestmarke |
Doch selbstverständlich sind auch einige slowenische Fahnen dabei. Um diese zu identifizieren, muss man aber schon ganz genau hinsehen. Denn leicht machen es die Slowenen dem Rest der Welt in dieser Hinsicht nun wahrlich nicht unbedingt. Nicht nur dass man genau die gleiche Längsstreifenkombination ausgesucht hat wie Russland und diese einzig durch das Nationalwappen ergänzt. Es gibt auch noch eine weitere Nation, die genauso verfährt. Und das ist ausgerechnet das Land, mit dem man ohnehin ständig verwechselt wird, die Slowakei.
Während die Slowaken ein Doppelkreuz führen, zeigt das slowenische Wappen einen Berg mit drei Spitzen. Er soll den Triglav darstellen, den mit 2863 Metern höchsten Gipfel des Landes. Doch ist der "Dreikopf" weit mehr als nur ein Berg, er ist zudem ein wichtiges nationales Symbol. Jeder Slowene sollte ihn mindestens einmal bestiegen haben, sagt man. Und nicht umsonst ist er auch auf dem Fünfzig-Cent-Stück verewigt.
Die Fahnenverwirrung wird noch größer, weil andere Staaten wie Kroatien und Serbien in ihren ebenfalls längsgestreiften Flaggen ebenfalls die gleichen "slawischen" Farben - wenn auch in anderer Reihenfolge - zeigen. Tschechien hat zumindest ein anderes Muster gewählt. Doch als Nationalfarben taugen sie nun wirklich nur sehr bedingt. Zumal neben vielen Osteuropäern zum Beispiel auch noch Franzosen, Briten, US-Amerikaner und Norweger die gleichen besitzen.
So setzen die slowenischen Auswahlteams im Sport zur besseren Unterscheidung dann auch meist auf grün, hellblau oder eine Kombination von beiden. Auch der Marathon von Ljubljana hat ein grün-schwarzes Logo. Doch ist dies vielleicht tatsächlich Zufall. Es trifft sich auf jeden Fall ganz gut, dass grün im Moment einer der Modetrends im Laufbereich ist. Denn nicht nur im T-Shirt für die Teilnehmer taucht es auf, auch die Jacken der Helfer haben diese Farbe.
Die mit immer größeren Lücken versehene Bebauung zeigt untrüglich, dass man sich dem Stadtrand nähert. Als man nach ungefähr neun Kilometern die Spitze des Fingers erreicht hat und mit einer Rechtskurve die um das erwähnte Bild beizubehalten vielleicht ein wenig zu sehr zur Gerade geratene Nagelkuppe in Angriff nimmt, ist auf der linken Seite tatsächlich bereits völlig freies Feld.
Wie in anderen Städte dieser Größenordnung auch hierzulande tut man sich in Ljubljana natürlich schwer damit, einen Kurs abzustecken, der wirklich durchgehend im städtischen Bereich bleibt. Selbst bei zwei Runden ist es eigentlich gar nicht möglich ohne die inzwischen eingemeindeten Vororte auszuholen. Überbrückungsstücke zum Beispiel durch Gewerbegebiete lassen sich dabei kaum vermeiden. Zumal ja auch noch Aspekte wie Verkehrsplanung einen Einfluss auf die Streckenwahl haben.
 |
 |
| Selbst Alemayehu Shumye auf Rang fünf bleibt mit 2:09:38 noch unter 2:10 | Die Halbmarathonis dürfen nach einer Runde abbiegen, beim Marathon geht es noch einmal geradeaus in eine weitere Schleife |
Den Bahnübergang, auf den man einen knappen Kilometer später zuläuft, kann man jedenfalls kaum vollständig sperren. Der Rechtsschwenk zurück Richtung Innenstadt ist schon alleine deshalb eigentlich logisch. Ähnliches gilt auch selbstverständlich für Autobahnen, die sich nur mit Brücken queren lassen. Und völlig abschneiden kann man einzelne Viertel ebenfalls nicht. Irgendwelche Schlupflöcher sollten schon offen bleiben.
So ist es durchaus erstaunlich, dass man es in Ljubljana schafft, die komplette Strecke während des gesamten Rennens vollkommen verkehrsfrei zu halten. Insbesondere eben auch auf der zweiten Runde, wenn das Feld der ohnehin nicht allzu vielen Marathonis weit auseinander gezogen und in ziemlich viele Einzelteile zerlegt vorbei kommt.
Allerdings zieht man die Sache dann nicht unnötig in die Länge und gibt die Strecke nach fünf Stunden wieder frei. Eine Schlusszeit, die hierzulande inzwischen einen Aufschrei des Entsetzens auslösen würde, selbst wenn sie einst einmal als völlig normal galt. In Ljubljana kommen nicht einmal hundert Läufer jenseits der viereinhalb Stunden ins Ziel. Da wirkt die gewählte Begrenzung durchaus akzeptabel. Die Hauptstraßen für ein paar Nachzügler noch länger zu sperren, scheint angesichts solcher Werte jedenfalls kaum zu begründen.
"H2O" steht groß auf dem Schild, das den ersten Tisch der Verpflegungsstelle bei Kilometer zehn ankündigt. Wer auch nur ein bisschen im Chemieunterricht aufgepasst hat, dem ist also auch ohne jede Fremdsprachenkenntnis klar, dass es dort gleich Wasser gibt. In deutlich kleinerer Schrift kann man beim Näherkommen zudem noch das slowenische "Voda" und das englische "Water" lesen. Dass beides trotz ziemlich unterschiedlicher Buchstabenfolgen in der Aussprache fast gleich ist, macht den Helfern die zusätzlichen Zurufe recht leicht.
Das ebenfalls an Posten ausgegebene Elektrolyt-Getränk ist mit dem Markennamen angezeigt und macht deshalb bei der Identifizierung ebenfalls keine Probleme. Neben dem meist üblichen Obst sowie Keksen und Schokoladenstückchen gibt es - als eine auch international eher selten anzutreffende Variante für den Energienachschub - noch puren Zucker. Und zwar nicht etwa Trauben- sondern ganz normalen Würfelzucker. Andere Länder, andere Sitten.
Bei der Dichte der Versorgung hält man sich in Ljubljana ziemlich genau an die Vorgaben. Im Abstand von ungefähr fünf Kilometern hat man die Stationen aufgebaut, wenn auch aufgrund der doppelten Nutzung auf den beiden Marathonrunden nicht ganz exakt auf der jeweiligen Marke Dazwischen wartet zusätzlich dann jeweils noch eine Wasserstelle, so dass selbst deutlich wärmeres Wetter als an diesem doch eher unfreundlichen Tag keine Probleme machen dürfte.
Die mehr als zwei Kilometer lange Gerade immer entlang der Bahngleise, die den ersten der beiden Finger abschließt, beginnt dann auch mit einer Verpflegungs- und endet mit einer Wasserstelle. Verglichen mit dem ersten Teil deutlich städtischer ist diese zweite Hälfte der Runde. Doch hat auch sie weiterhin reinen Vorstadtcharakter. Anfangs führt die Straße nämlich durch ein Gewerbegebiet, später säumen meist mehrstöckige Wohnblocks die Strecke.
Selbst wenn man nach dem Verlassen der Gerade den Burgberg einmal direkt vor sich sieht, wird man das Zentrum Ljubljanas erst ganz zum Abschluss der Schleife wieder erreichen. Denn wenig später dreht der Marathonkurs auch schon wieder in eine andere Richtung ab. Der kleine Schlenker war nur nötig, um die Eisenbahn mit Hilfe einer Unterführung queren zu können.
Diesmal senkt sich die Straße tatsächlich so weit nach unten, dass auch hohe Lastwagen unter der Brücke hindurch kämen. Doch obwohl eine Absperrung eindeutig anzeigt, dass der offizielle Marathonkurs auf der mehrspurigen Hauptroute bleibt, ziehen es die meisten Läufer vor, auf den parallel verlaufenden Radweg hinüber zu wechseln. Denn auf diesem kann man angesichts des leichten Bogens, in den die Unterführung verläuft, nicht nur ein paar Strecken- sondern, weil er nicht ganz so tief angelegt ist, zusätzlich auch noch ein paar Höhenmeter sparen.
Erst an der nächsten großen Kreuzung sind beide Varianten wieder auf einem Niveau angekommen. Und dort biegt man nach links auf den zweiten Finger ein. Die Anatomie des Ljubljana Marathons ist allerdings dahingehend ein bisschen ungewöhnlich, dass dieser "Zeigefinger" der längere von beiden ist.
Fast drei Kilometer lang zieht sich die Strecke ohne jeden Knick durch die längst bekannte, unspektakuläre Mischung aus Industrie und Vorstadt. Nur weil die Straße nicht wirklich schnurgerade sondern leicht gekrümmt verläuft, kann man sie nicht in ihrer kompletten Ausdehnung einsehen. Bei Kilometer sechzehn piepen am entferntesten Punkt die Zwischenzeitenmatten und nur wenige hundert Meter später ist man nach zwei dicht aufeinander folgenden Neunzig-Grad-Kurven schon auf dem Rückweg.
Eine Trabantenstadt mit Wohnhochhäusern nimmt diese kurze Kante ein. Da will die Trachtenkappelle, die beim Einschwenken auf die breite Achse, auf der man den Rückweg antritt, Läufer und Zuschauer unterhält, irgendwie nicht wirklich passen. Wer sich mit Trachten nicht genau auskennt, könnte sie beim ersten Blick durchaus auch für Österreicher halten. Eine Aussage, die den Slowenen vermutlich nicht wirklich gut gefällt, aber andererseits in einem kleinen Detail zeigt, dass man eben doch viel mehr Alpen- als Balkanland ist.
 |
 |
| Kurz vor dem Einlauf auf dem Platz der Republik … | … wird noch einmal das slowenische Parlament passiert |
An einem kleinen privaten Wasserstand gibt es außerplanmäßig zusätzliche Flüssigkeit. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man, dass er sich vor dem "Birokrat Hotel" befindet, in dem wohl hauptsächlich Geschäftsreisende absteigen. Das im Deutschen ziemlich negativ besetzte Wort "Bürokrat" scheint jedenfalls nicht in allen Sprachen einen so schlechten Beigeschmack zu besitzen.
Auf die eigentliche Wasserstelle trifft man, nachdem man auf einer Brücke inzwischen schon zum vierten Mal die Stadtautobahn überquert hat. Da diese größtenteils in einem tiefer liegenden Trog verläuft, sind dabei jedoch keinerlei Höhenunterschiede zu überwinden. Gleich mehrere moderne und architektonisch ziemlich interessante Bürogebäude bilden den Hintergrund für die Tische. Und das Kasino von Ljubljana mitsamt angeschlossenem Luxushotel nimmt die gegenüber liegende Straßenseite ein.
Zumindest optisch ein wenig interessanter und abwechslungsreicher als die meisten bisherigen Passagen ist dieser Streckenabschnitt. Mehr als vier Kilometer wird bis zum Startbereich auf der Slovenska cesta keine einzige Kurve mehr folgen. Ein wenig später folgt ein weiterer auffälliger Büroblock. Der davor angebrachte Schriftzug "Hypo Alpe Adria" zeigt, dass es sich um den Sitz des hierzulande als Pleitebank bekannten Unternehmens handelt.
Doch durchgängig spektakulär ist natürlich auch diese schier endlose Gerade nicht. Zwischendurch übernehmen wieder Wohnblocks das Kommando über den Straßenrand. Erst das Messegelände knapp zwei Kilometer vor dem Ende der Runde ist dann wieder erwähnenswert, wenn auch keineswegs etwas wirklich Besonderes.
Die Markierung zeigt schon den letzten Kilometer der Runde an, als die Bahnstrecke, die ziemlich markant die nördliche Grenze der Innenstadt definiert, erneut unterquert wird. Spätestens nachdem sie die kurze Rampe auf der anderen Seite überwunden haben, beginnt für die Halbmarathonläufer der Endspurt.
Mindestens ein Dutzend aufeinander folgender Schilder sowie mehrere grüngewandete Helfer sortieren das Feld auseinander. "Halbmarathon nach rechts, Marathon nach links" zeigen sie an. Unterschiedliche Farben und Nummernkreise der Startnummern machen die Zuordnung leicht. Auch da ist die Organisation, die wirklich nicht den geringsten Anlass zur Kritik liefert, perfekt. Wer sich trotz all dieser Hilfen tatsächlich noch verlaufen sollte, dem ist wohl kaum noch zu helfen.
 |
 |
| Mit Begleitung in nicht unbedingt sportlichem Dress … | … und dem Besenwagen nähert sich der Schluss des Feldes nach fünf Stunden dem Ziel |
Als erster kommt Anton Kosmac auf dem Platz der Republik an. Dass er mit der 2000 die niedrigste aller für den Halbmarathon reservierten Nummern trägt, ist ein untrügliches Indiz für einen Favoritensieg. Doch muss sich der Slowene ganz schön lang machen um seinen Landsmann Urban Jereb mit 1:08:56 zu 1:08:58 auf Distanz zu halten. Platz drei geht nach Deutschland, denn den sichert sich in 1:09:37 Abderrahim Oukioud vom OSC Berlin.
Deutlich komfortabler ist da der Vorsprung, den Lidija Cerkovnik bei den Frauen herausläuft. Erst mehr als fünf Minuten nachdem ihre 1:20:59 im Ziel registriert worden ist, kommt nach 1:26:08 mit Katja Juhart die Zweite herein. Nur ganz knapp dahinter sichert sich nach 1:26:12 auch bei den Frauen ein Gast aus dem Ausland den letzten Treppchenplatz, Zsanett Móczó aus Ungarn.
Doch noch vor den Siegern sind die kenianischen und äthiopischen Asse auf die zweite Runde gegangen. In 1:04:26 rauscht rund ein Dutzend Afrikaner über die Zwischenzeitmatte, die vor der Ursulinenkirche mit ihrer ungewöhnlichen Dachform ausgelegt ist. Noch mehr als zehn Kilometer wird die Gruppe auf der Jagd nach dem Streckenrekord zusammen bleiben, bevor sie dann in ihre Einzelteile auseinander fällt.
Ein slowenischer Sieg ist zu diesem Zeitpunkt schon längst außerhalb jeglicher Reichweite. Denn volle acht Minuten vergehen, bevor der erste Einheimische vorbei kommt. So bleiben die zwei ersten Plätze von Roman Kejžar aus den Jahren 1996 und 2001 die bisher einzigen heimischen Erfolge. Mit 2:11:50 hält Kejžar übrigens auch den Landesrekord über die Marathondistanz.
Bei den Damen gab es neben drei Siegen der schon erwähnten Helena Javornik in den Anfangsjahren mit Daneja Grandovec und Nada Rotovnik-Kozjek noch zwei weitere slowenische Gewinnerinnen. Doch sind die Leistungen, die beide dafür erbringen mussten, nicht mehr unbedingt dem absoluten Hochleistungsbereich zuzuordnen.
Nur wenige Schritte wäre die absolut sehenswerte Altstadt Ljubljanas nun eigentlich noch entfernt. Doch in ihrem Bestreben eine möglichst schnelle Strecke anzubieten, sparen sie die Marathonmacher auch auf der zweiten Runde für die Marathonis komplett aus. Natürlich würden die engen Gassen mit ihren Kopfsteinpflaster einige Sekunden kosten, zumal auch noch ein paar Höhenmeter zusätzlich dazu kommen würden. Doch wenn man böse wollte, könnte man auch ein wenig von Etikettenschwindel sprechen.
Denn die Internetseite des Marathon ziert zum Beispiel ein Foto des Prešernov trg, jenes nach dem slowenischen Nationaldichter France Prešeren benannten Platzes, auf dem man beim Stadtbummel ganz unwillkürlich immer wieder landet. Er ist dann auch der Treffpunkt schlechthin. Einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die Franziskanerkirche stehen dort direkt. Die meisten anderen sind im Umkreis von wenigen hundert Metern zu erreichen.
 |
 |
| Noch einmal geht es direkt unter dem Startbogen hindurch ... | … bevor man durchs Ziel laufen darf |
Drei leicht auseinander laufende Brücken überspannen den Bogen, den die Ljubljanica genau auf Höhe des Platzes schlägt. Wer sie überquert kommt mit wenigen Schritten zum "Mestni trg" dem Stadtplatz mit dem Rathaus direkt unterhalb der Burg. Links davon befindet sich die Kathedrale der Stadt, deren Eingang sich in einer schmalen Gasse versteckt und um die herum der zentrale Markt Ljubljanas zu finden ist.
Und noch ein bisschen weiter überspannt eine Brücke das Flüsschen, die auf beiden Seiten von Drachenfiguren bewacht wird. Der Drache ist schließlich - auf der Burg sitzend - das Wappentier Ljubljanas. Nicht nur auf der Drachenbrücke kann man ihm begegnen. Auch an anderen Stellen ist er noch verewigt. Sogar die Wagen der Müllabfuhr sind ja mit einem freundlichen Drachen bemalt.
Weit einsamer als die erste Runde verläuft die zweite Marathonschleife. Und zwar nicht nur, weil der größte Teil des gestarteten Feldes es bei der kurzen Distanz belassen hat. Wie meist in solchen Konstellationen ist auch in Ljubljana nach Halbmarathon die Party eigentlich vorbei. Die Musikkapellen haben bereits eingepackt, viele der Zuschauer sind längst abgewandert. Am ausdauerndsten sind in dieser Beziehung zumeist noch die Kinder, die auch bei der zweiten Passage eifrig Hände zum Abklatschen entgegen strecken.
Das gilt natürlich hauptsächlich für das Mittel- und Hinterfeld. Denn als die schnellsten Marathonis dem Trg republike entgegen rauschen, ist kaum die Hälfte der Läufer auf der halb so langen Distanz im Ziel. Einzeln aber in dichter Folge kommen die Asse aus dem afrikanischen Hochland herein und erfüllen die in sie gesetzten Erwatungen voll und ganz.
Um fast zwei Minuten drückt Daniel Too den bisherigen Streckenrekord. Der neue, den es im nächsten Jahr zu attackieren gilt, steht nun bei 2:08:25. Joseph Lagat folgt als Zweiter fünfundzwanzig Sekunden dahinter. Im harten Kampf um Platz drei hat Michael Chege am Ende mit 2:09:12 gegen den 2:09:19 laufenden Äthiopier Berhanu Shiferaw die Nase knapp vorne. Und auch Alemayehu Shumye bleibt mit 2:09:38 noch unter 2:10.
Für den mit dem besten Hausrekord ausgestatteten Daniel Rono bleibt gerade einmal Rang sechs. Doch bleibt er in 2:10:11 ebenfalls noch eine Sekunde unter der bisherigen Kursbestmarke. Für Vorjahressieger Evans Ruto bleibt trotz einer 2:12:37 sogar gerade einmal Rang neun. Dazwischen schieben sich noch Kiprotich Kenei aus Kenia (2:11:12) und Shumi Eticha aus Äthiopien (2:12:30). Mario Vracic als bester Slovene auf Rang zwölf befindet sich da mit 2:31:48 in einer völlig anderen Liga.
Weit weg ist man dagegen bei den Frauen von der Streckenbestzeit, doch hat Caroline Cheptanui Kilel diese 2009 ja auch auf 2:25:24 geschraubt und die Latte angesichts der noch nicht ganz so großen Leistungsdichte bei den Damen ziemlich hoch gelegt. Aber auch hier geht der Sieg durch Lydia Kurgat nach Kenia. In 2:33:01 lässt sie ihre 2:33:42 laufenden Landsfrau Jane Rotich hinter sich.
 |
 |
| Im Zielraum verteilen fleißige Helfer Medaillen und ein Lauftrikot an die Marathonis | |
Den totalen kenianischen Triumph verhindert nach 2:35:04 die Ukrainerin Ilha Kotovska, die der lange mit ihr gemeinsam laufenden Rebecca Jerotich (2:38:51) auf dem letzten Streckenviertel noch deutlich die Hacken zeigt. Neža Mravlje ist als schnellste Einheimische mit 2:42:00 gar nicht einmal so weit dahinter. Und Daneja Grandovec belegt durch ihre 2:43:33, dass sie noch deutlich schneller unterwegs sein kann als bei ihrem Sieg vor einigen Jahren.
Der Ljubljanski Maraton macht mit diesen Ergebnissen leistungsmäßig eindeutig einen Schritt nach vorne und kann sogar eine einige Sekunde schnellere Siegerzeit präsentieren als Wien. Zu einem Marathon von internationalem Gewicht ist er damit noch nicht geworden. Dafür müsste er wohl noch deutlich weiter wachsen und insbesondere auch noch deutlich mehr Ausländer anziehen.
Ljubljana ist zwar keine Metropole wie London, Paris, Rom oder Madrid, in denen man eine Woche verbringen kann und dennoch ständig neues entdeckt. Doch für einen Wochenendausflug bietet sich die schmucke Altstadt durchaus einmal an. Dass man sie während des ganzen Marathons eigentlich nicht wirklich zu Gesicht bekommt, ist sicher der kleine Schwachpunkte einer freundlichen und gut organisierten Laufveranstaltung.
Vielleicht ist der Marathon ja auch eine Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad der slowenischen Hauptstadt zumindest ein bisschen zu steigern. Weder in Polen noch in Bulgarien sollte man Ljubljana nämlich suchen. Und mit der Slowakei sollte man Slowenien ganz sicher auch nicht verwechseln. Ganz egal, ob man dort einmal gelaufen ist oder nicht. Die Frage "wo ist denn Ljubljana?" muss nämlich nicht sein.
 |
Bericht und Fotos von Ralf Klink Ergebnisse und Infos www.ljubljanskimaraton.si Zurück zu REISEN + LAUFEN – aktuell im LaufReport HIER |
 |
© copyright
Die Verwertung von Texten und Fotos, insbesondere durch Vervielfältigung
oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne Zustimmung der LaufReport.de
Redaktion (Adresse im IMPRESSUM)
unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.